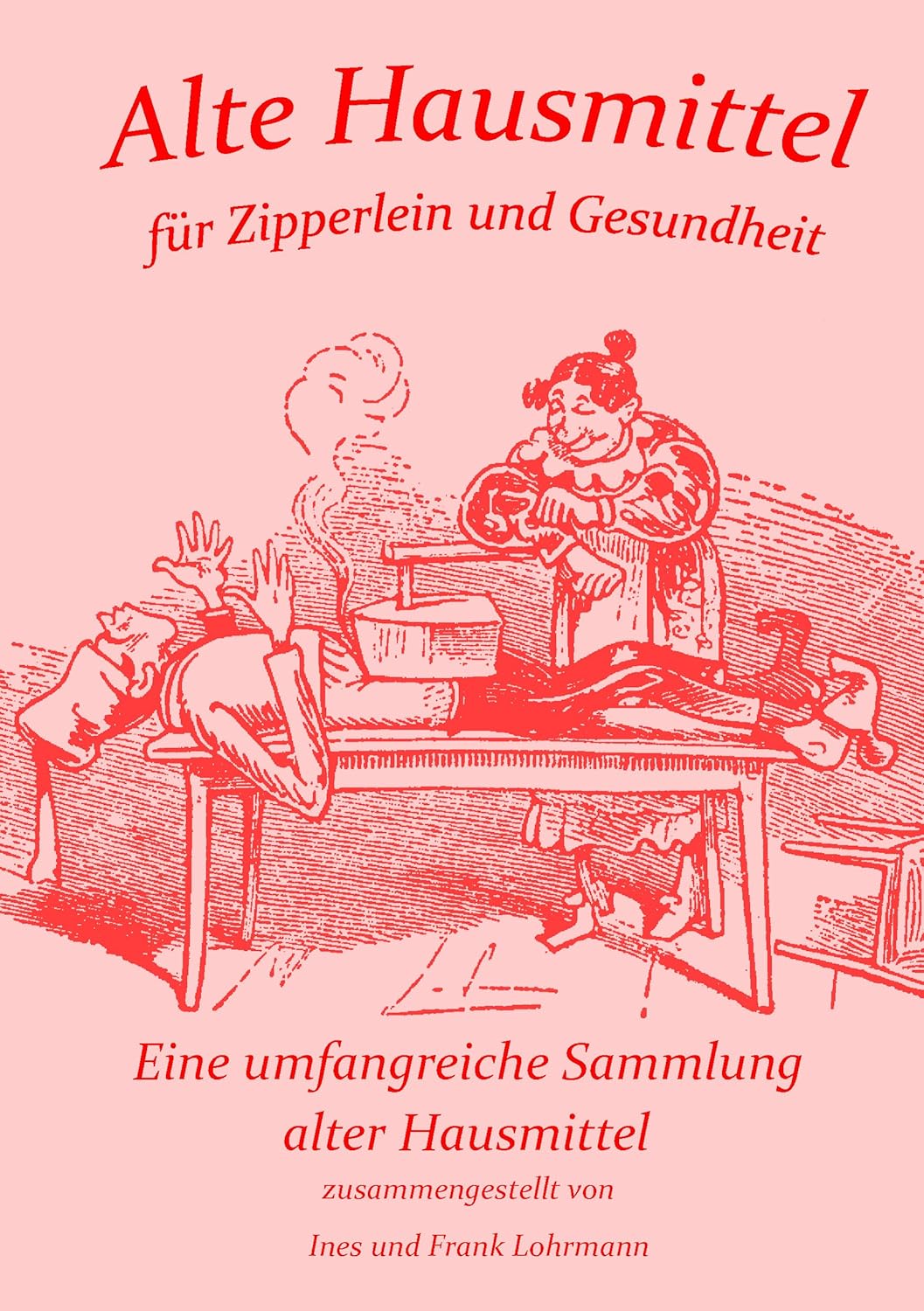Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Weber-Karde - Dipsacus sativus (L.) Honck.
Französisch: cabaret des oiseaux, Cardere, grande verge de pasteur, lavoir de Venus, peigne á loup, tete de loup
Englisch: Fuller's teasel, Venus bath, Wild teasel

© ktfujimoto
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Synonyme dt.:
Färberkarde
Kardendistel
Raukarde
Tuchkarde
Weber-Karde
Weberdistel
Weberkarde
Wilde Karde
Wollkarde
Synonyme :
Dipsacus fullonum Huds.
Dipsacus fullonum Mill.
Dipsacus fullonum subsp. fullonum
Dipsacus fullonum subsp. sativus (L.) Thell.
Dipsacus fullonum subsp. sativus (L.) Thell. ex P.Fourn.
Dipsacus fullonum subsp. sativus (L.) Thellung
Dipsacus fullonum var. sativus (L.) Schmalh.
Dipsacus fullonum var. sativus (L.) Thell
Dipsacus fullonum var. sativus L.
Dipsacus fullonum var. technicus Alef.
Dipsacus fullosum subsp. sativus (L.) Thull.
Dipsacus sylvestris subsp. fullonum Bonnier & Layens
Blatt: Die stengelständigen, verwachsenen Blätter bilden eine Art Wasserreservoir („Venus-Waschbecken"), durch welches flügellose Insekten von den Blüten ferngehalten werden.
Stengel bzw. Stamm: zweijährige bis 200 cm hohe Pflanze mit grundständiger Rosette, aufrechtem, kantigem, an den Kanten stachligem Stengel, dessen länglich-lanzettlichen, stacheligen Blätter an der Basis paarweise miteinander verwachsen sind, 5—8 cm langen und violetten, selten weißen Blütenköpfen.
Blüte: Blütezeit: Juli bis August
Vorkommen: Europa, Nordafrika, Westasien.
Wurde für die Tuchfabrikation angebaut und ist hier und da verwildert, jetzt weit verbreitet, an Wegrändern, auf wüsten Plätzen, lehmhaltigen Böden, verbreitet, kalkliebend
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Die Köpfe wurden zur Herstellung von Stoffen wie Wolle, Flanell und Samt verwendet werden.
Die Blütenköpfe wurden zum Kämmen und Bürsten von Wolle benutzt. Dieser Vorgang heißt auch heute noch kardieren.
Die Pflanze wurde auch als Färbemittel verwendet, da sich aus der getrockneten Pflanze wasserlöslicher blauer Farbstoff als Indigosubstitut gewinnen lässt. Gelb gewinnt man, wenn man das Pflanzenmaterial mit Alaun vermischt.
Medizinisch:
Karden wurden schon von den alten griechischen Ärzten gebraucht und besonders die Wurzel äußerlich angewendet.
Dioskurides schreibt vom Dipsacus: Seine Wurzel mit Wein oder mit Essig gestoßen, so dass sie die Konsistenz von Wachssalbe annimmt, heilt, hineingelegt, Risse am After und Fisteln. Man muss aber das Mittel in einer ehernen Büchse aufbewahren. Dasselbe soll auch ein Heilmittel für gewöhnliche und gestielte Warzen sein und kann bei Phthisis versucht werden. Äußerliche Anwendung findet das Mittel gegen Rhagaden, Fistulae ani, Liehen und als
schmerzlinderndes Mittel zu Einreibungen bei Gicht und Rheuma.
Die Pflanze wird wenig in der modernen Kräutermedizin verwendet, seine therapeutischen Wirkungen gelten als umstritten. In der Volksmedizin diente die Pflanze der Behandlung von Warzen, Fisteln und Krebsgeschwüren.
Eine Infusion aus den Blättern wurde als Wäsche bei Akne genutzt.
Die Wurzel wirkt diuretisch, diaphoretisch, stomachisch. Eine Infusion verwendete man als appetitanregendes und magenstärkendes Mittel. Sie sollte auch die Leberfunktion stärken und wurde bei Gelbsucht verwendet. Geerntet wurde die Wurzel im Frühherbst und anschließend getrocknet.
Gegen Krebs verwendete man eine Salbe aus den Wurzeln. Diese diente auch der Behandlung von Warzen, Muttermalen und Nagelbettentzündung.
Aktivität:
Schweißtreibend; Entwässernd.
Indikation:
Dermatosen; Ekzeme und Neurodermitis; Entzündungen; Fieber; Fisteln; Krebs; Nagelbettentzündung; Peniskrebs; Rhagaden; Rheumatismus; Talgzysten; Warzen; Wassereinlagerungen; Wunden;
Dosierung:
äußerlich als Salbe
2 x täglich 0,125 g Frischkraut
In der Homöopathie: bis dil. D 1, dreimal täglich 10 Tropfen
Speisewert:
Medizinisch
Abmessungen:
Frucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher  Stacheln an Stamm oder Blatt
Stacheln an Stamm oder Blatt Blütezeit
Pflanze Jährigkeit
Haare
 Haare drüsig, warzig
Haare drüsig, warzig Blätter
 Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)
Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Blätter mehrteilig, verzweigt, kompliziert
Blätter mehrteilig, verzweigt, kompliziert  Blätter gefiedert (4 oder mehr Blätter)
Blätter gefiedert (4 oder mehr Blätter)  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt
Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt  Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.
Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen Blütenstand
 Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial
Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial Blüten
 bisexuell
bisexuell  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig
zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig  Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend
Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6  Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 0 (inkl. 1 becherartiger Kelch ohne Lappen)
Kelchblätter 0 (inkl. 1 becherartiger Kelch ohne Lappen)  Kelchblätter 2
Kelchblätter 2  Kelchblätter 4
Kelchblätter 4  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter mehr als 5
Kelchblätter mehr als 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)
Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)  Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt
Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt  Blütenblätter 4
Blütenblätter 4  Blütenblätter 5
Blütenblätter 5  Blütenblätter 6
Blütenblätter 6  Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)
Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)  Blütenblätter schuppig
Blütenblätter schuppig  Staubbeutel 2, fruchtbar
Staubbeutel 2, fruchtbar  Staubbeutel 4, fruchtbar
Staubbeutel 4, fruchtbar  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubblätter in die Krone eingefügt
Staubblätter in die Krone eingefügt  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - in getrennten Bündeln
Staubfäden verwachsen - in getrennten Bündeln  Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)
Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Fruchtblatt 1
Fruchtblatt 1  Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  Fruchtblätter frei von einander oder 1 Fruchtblatt
Fruchtblätter frei von einander oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)
Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Frucht mit Flügeln
Frucht mit Flügeln  Frucht mit Haaren zur Windverbreitung
Frucht mit Haaren zur Windverbreitung  Keim gerade
Keim gerade  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe  Samen mit Nährgewebe
Samen mit Nährgewebe Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Europa
Europa  Previous
Previous