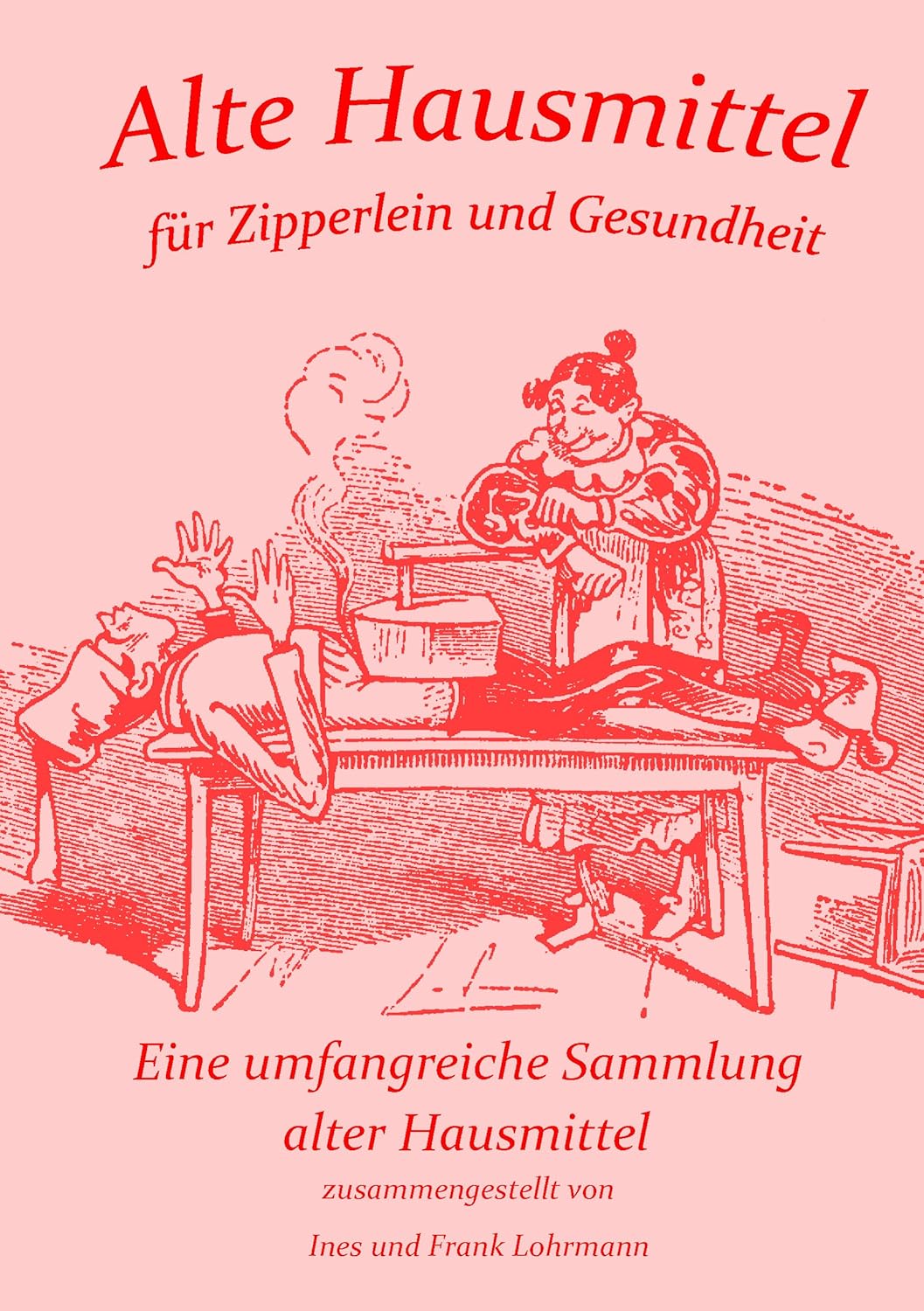Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Gemeiner Wacholder - Juniperus communis L.
Englisch: Common Juniper, Aiten, Aitnach, Alpen-Wacholder, Common-Juniper, common juniper, Dwarf juniper, Etnach, Fairy-circle, Fairy circle, Fairy circles, Gaagaagiwaandag, Gaskas, Gasngese, Gorst, Ground Juniper, Ground Juniper", Hack-matack, Hack matack, Hacmatack, Horse savin, Ipswich Mass, Irish juni per, Jenepre, juniper, Juniper-berry, Juniper-bush, Juniper-tree, Juniper bark, Juniper ber ries, Juniper bush, Ju niper tree, Low Juniper, Malchangel, Mountain juniper, Prostrate Juniper, Riätká, Swedish juniper, Trailing juniper
Portugiesisch: zimbro
Spanisch: buto, ciprés, enebrina, Enebro, enebro común, enebro real, ginebro real, junípero, nebrina, nebro, sabina, yunípero
Französisch: Genevrier, Geniere, Geniev commun, Genévrier commun, Petron
China: 歐洲刺柏 ōuzhōu cibăi
Russisch: можжевельник обыкновенный

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Echter Wacholder
Feuerbaum
Gemeine Wacholder
Gemeiner Wacholder
Gewöhnlicher Wacholder
Heide-Wacholder
Johandel
Krametsbaum
Krammetsbeerbaum
Kraunbaum
Machandelbaum
Rackholder
Wacholder
Zwerg-Wacholder
Zwergwacholder
Synonyme :
Juniperus caucasica Fisch. ex Godr.
Juniperus communis f. aurea (G.Nicholson) Rehder
Juniperus communis f. aureospica (Rehder) O.L.Lipa
Juniperus communis f. compressa (Carrière) Rehder
Juniperus communis f. oblonga-pendula (Loudon) Beissn.
Juniperus communis f. pendula (Carrière) Formánek
Juniperus communis f. pendulina Kuphaldt
Juniperus communis f. pungens Velen.
Juniperus communis f. stricta (Carrière) Rehder
Juniperus communis var. arborea Suter
Juniperus communis var. aurea G.Nicholson
Juniperus communis var. aureospica Rehder
Juniperus communis var. compressa Carrière
Juniperus communis var. oblonga-pendula Loudon
Juniperus communis var. pendens Sudw.
Juniperus communis var. pendula Carrière
Juniperus communis var. pendula-aurea Sénécl.
Juniperus communis var. reflexa Parl.
Juniperus communis var. stricta Endl.
Juniperus communis var. variegata-aurea Carrière
Juniperus depressa Raf. ex McMurtry
Juniperus nana f. canadensisaurea Beissn.
Juniperus oblonga-pendula (Loudon) VanGeert
Juniperus oblonga-pendula (Loudon) VanGeert ex K.Koch
Juniperus reflexa Godr.
Pyramidal- kegelförmige oder niederliegende träucher, seltner mittelgrosse Bäume.
Blatt: Laubblätter nadeiförmig, in abwechselnd 3 (selten 4) gliederigen Quirlen stehend. Nadel am Grunde angeschwollen und mit einem Gelenk am Stengel angeheftet, spitz, 8 bis 21 (selten bis 30) mm lang, etwas rinnig, anfangs aufgerichtet, später abstehend bis zurückgeschlagen, meist graugrün, seltener lebhaft grün, von einem sehr weiten Harzgang durchzogen.
Stengel bzw. Stamm: Strauch oder Baum, bis 11 m hoch werdend, meist vom Grunde an verzweigt, seltener bei baumartigen Exemplaren einen 1 bis 2 (vereinzelt bis 12) m hohen Stamm entwickelnd. Rinde anfänglich glatt, später rissig, sich faserig abschälend und graubraun werdend. Keimling mit 2 Kotyledonen.
Blüte: Knospen von schuppenartigen Nadeln bedeckt. Blüten zweihäusig, hie und da auch einhäusig. Zwitterblüten sehr selten. Die männlichen und weiblichen Blüten werden im Herbst als kurze Seitensprosse in den Blattachseln der mittleren Nadelquirle eines Zweiges angelegt. Die männlichen Blüten sind gelb, stehen einzeln, sind meist schräg nach abwärts gerichtet, sehr kurz gestielt, von eiförmiger Gestalt, 4 bis 5 mm lang, aus mehreren Quirlen bestehend. Staubblätter schildförmig, mit schuppenförmiger Spreite, am untern Rande 3 oder 4 (seltener bis 7) Pollensäcke tragend, die sich durch Löcher öffnen. Blütezeit April, Mai.
Frucht bzw. Samen: Pollen oft weisslich, in manchen Gegenden viel Stärke enthaltend. Dieser wird in Form von kleinen Wölkchen entlassen. Weibliche Blüten kleinen Laubknospen ähnlich, einzeln, aufgerichtet, grün, 2 mm lang, aus mehreren 3 gliedrigen Quirlen von dreieckigen, schuppenförmigen Fruchtblättern bestehend, von denen in der Regel die 3 gipfelständigen, konkav gekrümmten je eine Samenanlage enthalten. Fruchtblätter fleischig werdend und die holzigen Samen in einer kugeligen Scheinbeere (Beerenzapfen) einschliessend. Unreife Beeren grün, saftlos, von unangenehmen Geschmack; reife Beeren (im zweiten Jahre) schwarzbraun, bläulich bereift, kugelig bis eiförmig, 4 bis 9 mm dick, kurz gestielt. Samen hellbräunlich, ungeflügelt, von länglicher etwas kantiger Gestalt, mit knochenharter Schale.
Vorkommen: Nordamerika, Südgrönland, Nordafrika, Europa, Asien, bis 4100 m Höhe. Verbreitet als Unterholz in lichten Nadelholzwäldern (besonders unter Föhren), auf Heide- (hier oft baumartig) und Moorboden, auf Bachgeschiebe, an unfruchtbaren Hügeln, auf Weideflächen, von der Ebene bis in die Hochalpen, ohne Unterschied des Gesteins. Oft auch in Gärten gepflanzt. Fehlt in Deutschland im nordwestdeutschen Flachlande an der Nordseeküste sowie in Schleswig-Holstein fast gänzlich.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Zierpflanze, Nutzpflanze. Aus den Beeren lässt sich brauner Farbstoff gewinnen.
Auch das Holz wird verwertet als Drechslerholz; Holz für Pfeifenröhren, Spazierstöcke, Zahnstocher; auch Bleistiftholz.
Genussmittel, Nahrungsmittel:
Blätter: jung zu Tee, getrocknet/gemahlen zu Streckmehl, Würze/Gewürz
Triebe: jung als Würze zu Gemüse, mit Wasser und Zucker gekocht zu Sirup
Früchte: Mus zu Würze/Gewürz, Fruchtsaft, Tee, Likör, Spirituosen, getrocknet zu Würze/Gewürz
innere Rinde: Gemüse
Die Früchte sind offizinell und werden bei Verdauungsbeschwerden und zum Ausschwemmen von Wasser verwendet, die Wirkung ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt und umstritten.
Das Oleum Juniperi wird verwendet. Die Beerenzapfen werden unter dem Namen Wacholderbeeren als Gewürz verwendet.
Medizinisch:
Die Beeren des Wacholders waren schon im Altertum als Antiseptikum und diuretisches Heilmittel bekannt. Aber nicht nur bei den alten Griechen und Römern, sondern auch bei den Germanen soll der Wacholder schon als Heilmittel bekannt gewesen sein. Leonhart Fuchs (1543) schreibt ihm alle möglichen guten Eigenschaften zu: er wirke auf den Magen, reinige und öffne Nieren und Leber, töte die Würmer und hülfe gegen Krampf und Hüftweh. Auch wurden im Mittelalter Räucherungen mit Wacholder sehr viel bei ansteckenden Krankheiten, besonders bei Pestepedemien, gemacht. Junge Triebe von Wacholder werden abgekocht und den Pferden gegen Kropf eingegeben. Zerstoßene und zerdrückte Wacholderbeeren gelten als einfaches, magenstärkendes und Kopfschmerzen stillendes Mittel, ebenso als diuretisches und antituberkulöses Mittel. Die Beeren wurden auch zum Konservieren von Fleisch benutzt. Das Harz wurde früher als Wacholderharz, deutscher Sandarak oder als unechter Weihrauch verkauft.
Überdosiert können Beeren Magen- und Nierenreizungen auslösen.
In der Ayurveda wird die Pflanze unter dem Namen Hapusha verwendet. Die Früchte helfen bei der Schleimsekretion und werden deshalb bei Husten und Erkältung eingenommen, sie gelten auch als Mittel gegen Blähungen.
Früchte und Samen enthalten Ameisensäure, Essigsäure, Apfelsäure, Cyclohexitol, Terpen, fermentierbare Zucker, Proteine, Wachs, Gummi, Pektine, Glycolsäure, Ascorbinsäure, d-Pinen,
Camphen, Caren, Cadinen, Juniper, Kampfer, Kohlenwasserstoff-Junene, Dihydrojunene.
Die Nadeln enthalten Biflavone, Cupressuflavon, Amentoflavon, Hinokiflavon, Isocryptomerin, Sciadopitysin Monoterpen-Glucosid, verschiedene Megastigman-Glykoside.
Das Holz enthält Umbelliferon, Ascorbinsäure, Harzester, Sesquiterpen, Polysaccharid-Galactan, Glucosan, Mannan, Araban, Xylan, Phydroxybenzaldehyd, Sugiol, Junenol, Thujopsen, Cuparen, Humulen, Cedrol, Widdrol, Longifolen, Monoterpene.
Die Rinde enthält Communinsäure, Juniperol, Sitosterol, Oxalsäure, Harze, Juniperin, Junipinen, Macroperol, Ferruginol, Silvestren, Diketoferruginol.
Das ätherische Öl enthält Neolignan Glykoside: Junipercomnosid A, Junipercomnosid B, Icarisid E4, Isoscutellarein, Xylopyranosid, Hypolaetin, Kaempferolrhamnopyranosid, Quercitrin, Nicotiflorin„ Atropisomeren, Cupressuflavone, Tannine, Monoterpenkohlenwasserstoffe, Monoterpen, Sesquiterpen, Pinen, Sabinen, Limonen, Myrcen, Geigerone.
In Studien wurde nachgewiesen, dass die Pflanze antimykotisch wirkt und Wirkungen gegen Skabiose, Malaria, Rheuma Durchfall und Tumore hat. Sie wirkt auch abtreibend, antimikrobiell und kann auch die Eiimplantation in der Gebärmutter verhindern.
Die Früchte wirken antiparasitär gegen Sarcoptes und andere Formen der Räude bei Schafen sowie gegen Pilzinfektionen bei Rindern.
Volksmedizin:
Der Wacholder spielte in der Volksmedizin eine sehr große Rolle. Besonders sind es die Beeren, die sich bei verschiedenen
Krankheiten eines großen Ansehens erfreuten. Sie sind ein uraltes Antiseptikum. In den Pesthäusern des Mittelalters wurde mit Wacholderbeeren geräuchert. Einen Nachklang an diesen Brauch bilden die Wacholderräucherungen der Stuben und Ställe am Dreikönigstage (6. Januar), wie sie in den Alpenländern noch heutzutage Brauch sind. Auch glaubte man vor ansteckenden Krankheiten sicher zu sein, wenn man die Beeren kaut. Die Kranewit-Salse (= Absud der Wacholderbeeren, zu Salse vergl. französisch Sauce) war dem oberbayerischen Bauer eines der beliebtesten Mitteln gegen Wassersucht. Außerdem werden die Beeren zum Konservieren von Fleisch und als Gewürz zum Sauerkraut (besonders in der Schweiz) und zum Gänsebraten
gebraucht.
Nach der vielseitigen Verwendung des Wacholders im Volke darf es nicht wundern, wenn sich auch der Aberglaube des Strauches bemächtigt hat. Er gehörte zu den Pflanzen, die den bösen Geistern höchst unangenehm sind. So nahm man in manchen Gegenden zum Buttern der Milch einen Rührstecken ausWacholderholz. Der Rauch des angezündeten Holzes vertreibt die Hexen und allen Teufelsspuck. Auch Krankheiten lassen sich unter gewissen geheimnisvollen Beschwörungsformeln auf den Strauch übertragen.
Aktivität:
Abführend; Allergieerreger; Anregend und Wachmacher; Anti-Candida; Anti-Exsudativ; Anti-Rheumatisch; Antibakteriell; Antiherpetisch; Antimalaria-Mittel; Antiseptisch; Antiviral; Aperitif; Aphrodisiakum; Augenmittel; Beruhigend; Bitterstoff; Blutdrucksenkend; Blutung stillend; Blutzuckersenkend; Brechreizhemmend; Entwässernd; Entzündungshemmend; Erweichend; Fiebersenkend; Fungizid; Gebärmutterkräftigend, Stärkend; Gegen Blähungen; Gewebezerstörend; Harnwege desinfizierend; Hypertensive; Krampflindernd; Kräftigend, Stärkend; Magenstärkend; Menstruationsfördernd; Muskelkontrahierend; Priapistisch; Reinigend; Schleimhaut abschwellend; Schleimlösend, Hustenlöser; Schmerzlindernd; Schutz vor Infektionen oder Giften; Schweißtreibend; Speichelfluss erhöhend; Verdauungsfördernd; Wasserausscheidung fördernd;
Indikation:
Ache; Anasarka; Appetitlosigkeit; Arteriosklerose; Arthrose; Asthma; Atemnot; Atmungsprobleme; Augenentzündungen; Ausbleibende Menstruation; Ausfluss; Bakterien; Bandwürmer; Bauchschmerzen oder Leibschmerzen; Bauchwassersucht; Bisse; Bleichsucht; Blennorrhoe; Blutandrang; Bluthochdruck; Blutungen; Blähungen; Bronchitis; Candida; Darmentzündungen; Dermatosen; Diabetes; Schmerzen; Durchfall; Einnässen; Entbindung; Entzündungen; Epilepsie; Erkältungen; Eructation; Fieber; Fisteln; Fußkrebs; Gallenblasenentzündung; Gallensteine; Gebärmutterentzündung; Gehirnentzündung; Gelbsucht; Geschwülste; Gewebeverhärtung; Gicht; Gonorrhoe; Grieß in Blase oder Niere; Grippe; Halsdrüsengeschwulst; Halsschmerzen; Harnblasenentzündungen; Harnröhrenentzündung; Harnstrenge; Hefeinfektionen; Hemikranie; Hepatose; Herpes; Herzentzündungen; Herzkrankheiten; Herzprobleme; Hexenschuss; Husten; Hydrozele; Hysterie; Hörprobleme; Infektion; Katarrh; Kolik; Kondylom; Krebs; Krämpfe; Krätze; Leberkrebs; Lähmungen; Magenerkrankungen; Magengeschwüre und Darmgeschwüre; Magersucht; Malaria; Mandelentzündung; Menstruationsbeschwerden; Milzkrebs; Mundfäule; Mundgeruch; Muskelschmerzen; Nasenkatarrh; Nephritis; Nervenschmerzen; Nervenschwäche; Nervosität und Unruhe; Neurosen; Nierenkrebs; Nierensteine; Odontosis; Pilze; Pilzinfektionen; Polypen; Psychosen; Pyelitis; Rheumatismus; Ruhr; Räude; Rückenschmerzen; Scheidenprobleme; Schlafstörungen; Schlangenbisse; Schmerzen; Schuppenflechte; Splenose; Steine; Strangurie; Tenesmus; Tiefer Blutdruck; Tuberkulose; Tumor; Vaginose; Venenentzündungen; Verbrennungen; Verdauungsstörungen; Verstauchungen; Verstopfung; Virus; Warzen; Wassereinlagerungen; Wassersucht; Wunden; Würmer; Zahnschmerzen; Ödeme;
Dosierung:
56–74 ml Tee;
10–15 Beeren/Tasse Tee;
1 Teelöffel (2–3 g) Beeren/150 ml Wasser 3–4 ×/Tag, für bis zu 4 Wochen;
1–2 g Frucht mehrmals ×/Tag;
1 Teelöffel frische Frucht;
1 g trockene Frucht: 5 ml Alkohol/5 ml Wasser;
2–4 ml flüssiger Frucht Extrakt 1:1 in 25% Alkohol 3 ×/Tag;
1–2 ml Fruchttinktur 1:5 in 45% Alkohol 3 ×/Tag;
0,03–0,2 ml Wacholderöl;
0,3–1,2 ml Wacholderspiritus;
1 Teelöffel Wacholdersirup morgens oder zur Nacht.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Nicht bei Psychosen oder Schwangerschaft und Stillzeit. Nicht für den Dauereinsatz über 4-6 Wochen.
Langzeit-Anwendung oder Überdosierung kann zu Nierenschäden führen. Nicht bei Nierenbeckenentzündung.
Äußerliche Anwendung des Öls kann Verbrennungen, Ödeme, Hautrötung und Blasenbildung verursachen.
Eine Überdosierung kann zu Blut im Urin, Priapismus, Strangurie und urämischen Krämpfen führen.
Kräuter mit entwässernden Eigenschaften wie Wacholder und Löwenzahn können den Lithiumspiegel im Blut erhöhen.
Speisewert:
Medizinisch
2 Bild(er) für diese Pflanze
Juniperus communis © Matt Lavin @ flickr.com |
Juniperus communis © José María Escolano @ flickr.com |
Abmessungen:
Frucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher
Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher  Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher Blütezeit
 Blütezeit April - 04
Blütezeit April - 04  Blütezeit Mai - 05
Blütezeit Mai - 05Pflanze Jährigkeit
 Mehrjährig
MehrjährigHaare
Blätter
Blütenstand
Blüten
Früchte
Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Europa
Europa  Nordamerika
Nordamerika  Previous
Previous