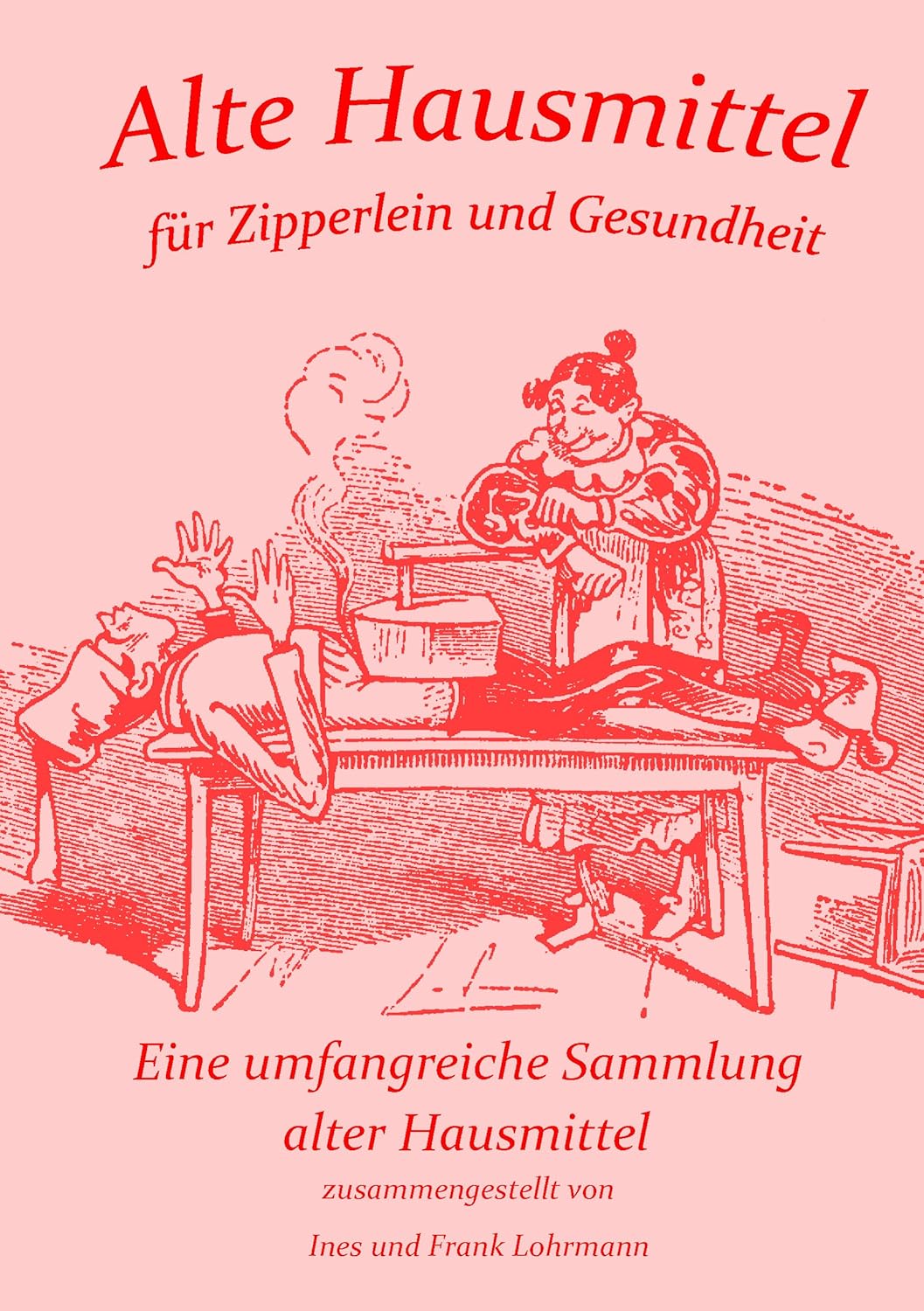Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Weißes Bilsenkraut - Hyoscyamus albus L.
Englisch: Russian Henbane, White henbane

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Weißes Bilsenkraut
Synonyme :
Hyoscyamus albus subsp. exserens Maire
Hyoscyamus albus subsp. major (Mill.) Batt.
Hyoscyamus albus subsp. major Bonnier & Layens
Hyoscyamus albus var. exserens Maire
Hyoscyamus albus var. major (Mill.) Lowe
Hyoscyamus albus var. major (Mill.) P.Fourn.
Hyoscyamus aureus All.
Hyoscyamus canariensis Ker Gawl.
Hyoscyamus canariensis KerGawl.
Hyoscyamus clusii G.Don
Hyoscyamus luridus Salisb.
Hyoscyamus major Mill.
Hyoscyamus minor Mill.
Hyoscyamus saguntinus Pau
Hyoscyamus varians Vis.
Wuchsform
- Typ: Einjähriges, zweijähriges oder ausdauerndes Kraut.
- Höhe: Bis zu 50 cm.
Blätter
- Form: Rundlich-eiförmig.
- Größe: 4–10 cm lang.
- Rand: Tief gezähnt.
- Blattstiel: 1–5 cm lang.
Blütenstände und Kelch
- Blütenstiele:
- Unterste Blüten: Mit Blütenstielen bis zu 8 mm lang.
- Andere Blüten: Sitzend (ohne Stiel).
- Kelch: 10–15 mm lang, breit röhrenförmig-glockenförmig.
- Lappen: Breit dreieckig, 1.5–2.5 mm lang.
Blüten
- Krone: Bis zu 30 mm lang, meist cremefarben oder weiß.
- Farbe: Im Schlund oft grün oder violett gefärbt.
- Staubblätter: Eingeschlossen oder leicht herausragend.
Früchte
- Fruchtkelch: Breit röhrenförmig-glockenförmig, in der unteren Hälfte leicht geschwollen, 20–25 mm lang.
Blatt: Alle Blätter gestielt, rundlich-eiförmig, buchtig-stumpflappig, aber geschweift.
Blüte: Blumenkrone hellgelb, mit violettem Schlünde. Im übrigen der vorigen sehr ähnlich. Blütezeit Mai, Juni.
Vorkommen: Südeuropa, Australien
Auf Schutt, Kulturland u. s. w. in Istrien und auf den Adriatischen Inseln.
Lebensraum
- Vorkommen: Diese Art wächst typischerweise in offenen, trockenen oder gestörten Lebensräumen und wird oft in wärmeren Regionen gefunden.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Aus dem Samenöl kann Seife hergestellt werden.
Medizinisch:
Das Bilsenkraut gehört zu den ältesten Giftpflanzen, die die indogermanischen Völker benutzten. Aber auch den Babyloniern, Ägyptern, Indern, Persern und Arabern war es sicher bekannt und wurde von ihnen als Heilmittel verwandt.
Die Bauern nutzten es als Gift gegen Ratten und Mäuse, es wurde daher viel gesammelt und auf den Speichern ausgelegt. In den Büchern des Mittelalters über Fisch- und Vogelfang findet das Bilsenkraut öfters Erwähnung und wird in verschiedenen Rezepten, die zum Betäuben der Fische oder Anlocken der Vögel dienten, aufgeführt.
Sehr giftige Pflanze; die Blätter, Folia Hyoscyami, sind offizinell und werden bei Krämpfen im Verdauungstrakt verwendet, sind jedoch nicht mehr gebräuchlich.
Blätter und Wurzel enthalten Alkaloide, Hyoscyamin, Scopolamin,
Scopolomin, Hyoscypierin, Cholin, Schleim, Albumin.
Enthält Atrompin, das krampflösend wirkt. Hat langanhaltende mydriatische Wirkung (Pupillenerweiterung).
Aktivität:
Abführend; Anti-CNS Tremors; AntiSchweißtreibend; Antiacetylcholine; Antichoinergikum; Aphrodisiakum; Bandwürmer; Beruhigend; Betäubend; Blutung stillend; Convulsant; Einschläfernd; Enthaarungsmittel; Fischgift; Gegen Blähungen; Gegenmittel bei Vergiftungen, Blei; Giftig; Krampflindernd; Muskelrelaxans; Parasympatholytikum; Pupillenerweiternd; Rauschmittel; Rodentifuge; Schlaffördernd; Schleimlösend; Schmerzlindernd; Speichelflusshemmend; Zusammenziehend;
Indikation:
Afterkrebs; Alkoholismus; Angina; Arteriosklerose; Arthrose; Asthma; Augenentzündungen; Augenkrebs; Ausbleibende Menstruation; Bandwürmer; Bewusstlosigkeit; Blasenkrebs; Blutungen; Blähungen; Bronchitis; Brustknoten; Brustkrebs; Chorea; Darmentzündungen; Delirium; Dentition; Diabetes; Schmerzen; Durchfall; Ekzeme und Neurodermitis; Entzündungen; Epilepsie; Erblindung; Erkältungen; Fieber; Fußkrebs; Gebärmutterentzündung; Gebärmutterkrebs; Geschwülste; Gesichtskrebs; Gewebeverhärtung; Gicht; Halsdrüsengeschwulst; Harnblasenentzündungen; Harnstrenge; Harte Krebsgeschwulste; Herzkrankheiten; Hodenentzündung; Hodenkrebs; Husten; Hydrophobie; Hypochondrie; Hysterie; Hämorriden; Karies; Katarrh; Kehlkopfentzündung; Keuchhusten; Kneiegelenkskrebs; Knochenhautentzündung; Kolik; Kondylom; Kopfschmerzen; Krebs; Krupp; Krämpfe; Krätze; Lungenentzündung; Lymphdrüsenerkrankungen; Magen-Darm-Krämpfe; Magenerkrankungen; Melancholie; Menstruationsbeschwerden; Morphinismus; Mundfäule; Nasenbluten; Nasenkatarrh; Nasenkrebs; Nervenschmerzen; Nervosität und Unruhe; Nyctalopie; Nymphomanie; Nystagmus; Ohrenschmerzen; Parotitis; Photophobie; Proctosis; Psychosen; Psychosen; Reisekrankheit; Restless Legs; Rheumatismus; Ruhr; Scharlachfieber; Scheidenprobleme; Schlafstörungen; Schluckauf; Schmerzen; Speicheldrüsenkrebs; Tremor; Tuberkulose; Tumor; Uvulosis; Verdauungsstörungen; Vernarbungen; Verstopfung; Wahn; Wechseljahre; Würmer; Zahnfleischentzündungen; Zahnfleischkrebs; Zahnschmerzen; Zuckungen;
Dosierung:
Zwischen 0,05 g, 0,15 g, 0,65 g, 1,0 g bis 3 g Blätter, entsprechend tägliche Maximaldosis von 1, 1,2, 1,5, 3, und 6 g Blätter, bei gemahlenen Blättern kleinere Dosen;
maximum Tägliche Dosis von 0,6 g gemahlenen Blättern;
0,5 g gemahlenes Kraut entsprechen etwa 0,25–0,35 Belladonna-Alkaloide;
0,4 g Blätter in Tee als Klistier zur Beruhigung.
In der Homöopathie; dil. D 3-4.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Nebenwirkungen wie für Belladonna-Alkaloide.
Überdosierungen können Herzrhythmusstörungen, Delirien, Harnstrenge, Erythem, Halluzinogene, Lethargie, Manie, Mydriasis, Obstipation, Tachykardie, Sehstörungen, Wassereinlagerungen und Xerostomie verursachen.
Nicht bei Arrhythmie, vergrößertem Dickdarm, GI Stenose, Glaukom, Prostadenom, Lungenödem und Tachykardie.
Die Blätter wurden als beruhigender Opium-Ersatz in der Kindermedizin verwendet.
Speisewert:
Medizinisch
4 Bild(er) für diese Pflanze
Abmessungen:
Frucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher  Kletterpflanzen, Lianen
Kletterpflanzen, Lianen  Stacheln an Stamm oder Blatt
Stacheln an Stamm oder Blatt Blütezeit
 Blütezeit Mai - 05
Blütezeit Mai - 05 Blütezeit Juni - 06
Blütezeit Juni - 06Pflanze Jährigkeit
 Zweijährig
Zweijährig Haare
 Haare drüsig, warzig
Haare drüsig, warzig  Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig
Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig  Haare Sternzellig (nicht 2-armig, verzweigt oder federig)
Haare Sternzellig (nicht 2-armig, verzweigt oder federig)  Haare verzweigt
Haare verzweigt  Haare federig, aber nicht drüsig
Haare federig, aber nicht drüsig  Haare schildförmig oder schuppig
Haare schildförmig oder schuppig Blätter
 Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Aderung handförmig in Blätter oder Blatteile
Aderung handförmig in Blätter oder Blatteile  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt
Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt  Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.
Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.  Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)
Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand eine Rispe, einfach und monopodial
Blütenstand eine Rispe, einfach und monopodial  Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)
Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 bisexuell
bisexuell  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig
zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig  Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)  Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)
Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 4
Kelchblätter 4  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter mehr als 5
Kelchblätter mehr als 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)
Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)  Kelchblätter schuppig oder verzerrt
Kelchblätter schuppig oder verzerrt  Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt
Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt  Blütenblätter 4
Blütenblätter 4  Blütenblätter 5
Blütenblätter 5  Blütenblätter 6
Blütenblätter 6  Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)
Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)  Blütenblätter verzerrten
Blütenblätter verzerrten  Blütenblätter hüllig oder becherig
Blütenblätter hüllig oder becherig  Staubbeutel 2, fruchtbar
Staubbeutel 2, fruchtbar  Staubbeutel 3, fruchtbar
Staubbeutel 3, fruchtbar  Staubbeutel 4, fruchtbar
Staubbeutel 4, fruchtbar  Staubbeutel 5, fruchtbar
Staubbeutel 5, fruchtbar  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubbeutel durch die Spitze öffnend
Staubbeutel durch die Spitze öffnend  Staubbeutel 1-kammerig zur Blüte
Staubbeutel 1-kammerig zur Blüte  Staubblätter in die Krone eingefügt
Staubblätter in die Krone eingefügt  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel
Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel  Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)
Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 2-kammerig
Fruchknoten 2-kammerig  Fruchknoten 3-kammerig
Fruchknoten 3-kammerig  Fruchknoten 4-kammerig
Fruchknoten 4-kammerig  Fruchknoten 5-kammerig
Fruchknoten 5-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  2 Samen pro Fruchtkammer
2 Samen pro Fruchtkammer  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt Früchte
 Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)
Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)  Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)
Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)  Frucht hat 2 Samen
Frucht hat 2 Samen  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Frucht mit Stacheln und Haken
Frucht mit Stacheln und Haken  Samen mit Flügeln
Samen mit Flügeln  Keim gerade
Keim gerade  Keim gekrümmt
Keim gekrümmt  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe  Samen mit Nährgewebe
Samen mit Nährgewebe Verbreitung
 Australien und Ozeanien
Australien und Ozeanien  Europa
Europa