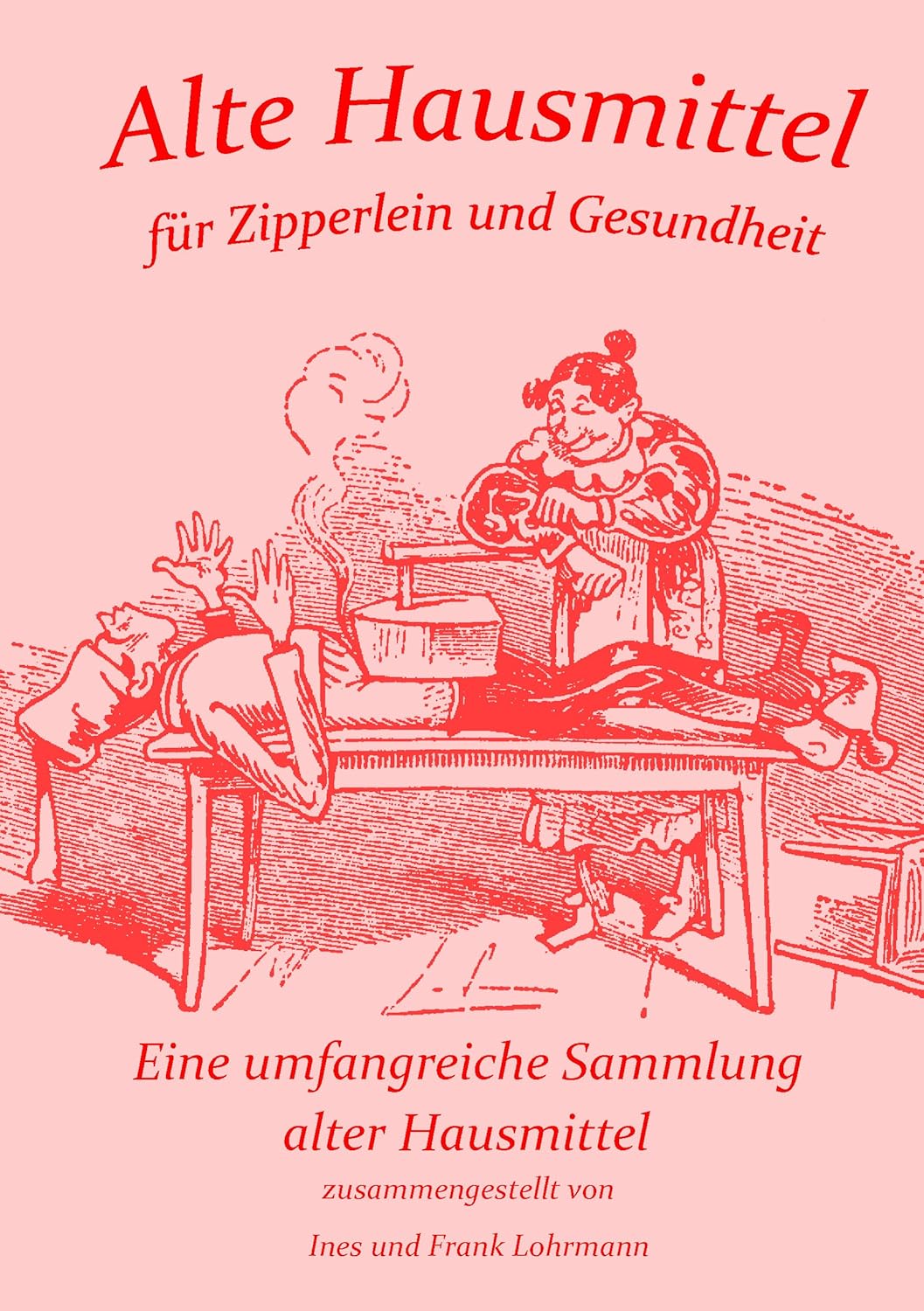Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Granatapfel - Punica granatum L.
Englisch: Africanisc æppel, Carthaginian apple, common pomegranate, Common pome granate, Dhelima, Dwarf Pomegranate, Granatum, Grenade, Gren adier, Nar, pomegranate, Pomegranate Tree, Pomgarnade, Punic-apple, Punic apple, Rodie, Shi liu, Wild pomegranate, Zakuro, انار, رمان, अनार, ডালিম, దానిమ్మ
Portugiesisch: granado, romã, romã-de-granada
Spanisch: balaustra, granada, granado, granda
Französisch: Grenadier
China: 番花榴 fānhuāliií, 石榴 shíliií
Russisch: гранат, гранатник обыкновенный

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Bolluster
Echte Granate
Echter Granatapfel
Granatapfel
Granatapfelbaum
Granatapfelstrauch
Granatbaum
Grenadine
Synonyme :
Granatum puniceum
Granatum punicum (L.) St.-Lag.
Punica florida Salisb.
Punica granatum var. granatum
Punica granatum var. sativum Maly
Punica grandiflora hort.
Punica grandiflora hort. ex Steud.
Punica multiflora Hort.
Punica multiflora Voss
Punica nana L.
Punica spinosa Lam.
Rhoea punica St.-Lag.
Blatt: Blätter gegenständig, au verkürzten Trieben büschelig, schwach -lederig, kurz -gestielt, länglich-lanzettlich bis umgekehrt-eiförmig, ganzrandig, kurz-zugespitzt, bis stumpf und fast ausgerandet.
Stengel bzw. Stamm: Strauch oder kleiner, unregelmässig verzweigter, oft dornig bewehrter Baum mit bis 8 m Höhe.
Blüte: Blüten regelmässig, zwitterig, einzeln, endständig und in den Achseln den obersten Blätter, honig- und geruchlos, homogam oder vorstäubend. Kelch, Blumenkrone und Blütenboden rot. Letzterer über den Fruchtknoten hinaus in eine unten fleischige Röhre vorgezogen. Kelch und Blumenkrone 5- bis 8-, meist 6 zählig; Staubblätter in unbestimmter Anzahl in vielen Kreisen; Blütezeit Juni, Juli.
Frucht bzw. Samen: Frucht eine apfelförmige, bis über 10 cm dicke, vom Kelche gekrönte Beere, mit dicker, lederartiger, blutroter, brauner, grünlicher oder gelblicher Schale. Ihr Inneres enthält, durch häutige Scheidewände getrennt, zahlreiche Samen, deren Aussenschicht saftig, durchsichtig, rosenrot ist und ihres erfrischenden Geschmackes halber genossen wird.
Vorkommen: Heimat: Südliches und westliches Asien, vielfach kultiviert, in Südtirol verwildert.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Zierpflanze, Nutzpflanze, Färbepflanze
Als eines der ältesten und beliebtesten Kulturgewächse spielt der Granatapfelbaum im Kulte der alten Völker eine große Rolle, und zwar bereits im syrisch phönizischen Götterdienste, dann als ahrmani bei den Ägyptern, wo er schon 2500 v. Chr. bekannt war. Die alten Kunstdenkmäler der Assyrer und Ägypter zeigen häufig Darstellungen des Granatapfels, und in den Gräbern der letzteren sind noch gut erhaltene Granatfrüchte aufgefunden worden. Aus dem säuerlichen, durstlöschenden Fruchtfleisch wurde eine Limonade hergestellt, die in den altägyptischen Texten als„schedech-it" erwähnt wird. Der griechische Mythos lässt die Granate aus vergossenem Blute entstehen und hält sie für einen Baum der Unterwelt. Die Granatäpfel galten infolge ihres Kernreichtums für ein Symbol der Fruchtbarkeit, sie waren der Persephone, Hera, dem Adonis und der Demeter geweiht.
In Spanien soll die Kultur des Granatapfelbaumes im 8. Jahrhundert durch die Araber eingeführt worden sein. Die im 10. Jahrhundert gegründete Stadt Granada erhielt von der Granate, welche auch das Stadtwappen zeigt, ihren Namen. Bald darauf wurde der Baum auch in Deutschland eingeführt. Im Mittelalter war der Granatapfel das Symbol der die köstlichste Frucht gebärenden Jungfrau Maria, die Blüte das Sinnbild der feurigen Liebe.
Auch in vielen ayurvedischen Schriften wird der Granatapfel erwähnt.
Genussmittel, Nahrungsmittel:
Frucht: wird roh gegessen oder zu Marmelade, Sirup, Saft (Grenadine) verarbeitet. Der weiche, frische Samen kann roh gegessen werden, getrocknet wird er in Indien als Anaedana-Gewürz verwendet. Die gekochten Blätter sollen auch essbar sein.
Medizinisch:
In Indien wird sie auch unter dem Namen Dadimah und Anar in der Ayurveda verwendet.
Wurzelrinde und Fruchtschale enthalten Pelletierin, Isopelletierin,
Methylisopelletierine, Methylpelletierine, Pseudopelletierin,
Gallusgerbsäure, Sitosterol, Ursolsäure, Maslinsäure, Ellagsäure,
Gallussäure.
Sie wird gegen Darmparasiten eingesetzt. Pelleterin wirkt gegen Bandwürmer. Es entspannt die Darmwand, wodurch die Bandwürmer mit Hilfe eines Abführmittels ausgetrieben werden können.
Ellagsäure soll krebsvorbeugende Wirkungen haben.
Die Wurzelrinde, Cortex Granati, ist offizinell.
Granatäpfel wirken auf Grund der enthaltenen Alkaloide als Anthelminthikum. Der Extrakt aus Blüten und Rinde wirkt antibakteriell und auch antifungal. Blätterextrakte auf Basis von Ethanol, Methanol, Hexan, Dichlormethan, und Ethylazetat wirken stark antioxidativ, entzündungshemmend, zytotoxisch und gegen Cholinesterase. Besonders wirksam sind alkoholische Extrakte gegen MCF-7 menschliche Brustkrebszellen.
Volksmedizin:
In der Volksmedizin wird die Pflanze gegen Würmer, Durchfall, Ruhr, als Abtreibungsmittel, als Gurgelwasser bei Halsschmerzen und extern bei Hämorrhoiden verwendet. In der Ayurveda wird sie bei Durchfall, Ruhr, Erbrechen und Augenschmerzen verwendet. In der chinesischen Medizin dient sie gegen chronischen Durchfall und Ruhr, zur Blutreinigung, bei Wurmbefall und Analprolaps. Die Blätter lindern Juckreiz, die Fruchtschalen werden bei Diarrhöe und Würmern, die getrocknete Fruchtschale wird als Sud, auch gemischt mit anderen Kräutern, gegen Koliken, Kolitis, Durchfall, Ruhr,
Weißfluss, Menorrhagie, Halsschmerzen, Mundgeruch und Nasebluten genutzt. Die Stammrinde wirkt emmenagogue und wird auch gegen Ruhr verwendet.
Aktivität:
Abtreibend Mundfäule; Alpha-Amylase Inhibitor; Amöbenzerstörend; Anregend und Wachmacher; Anti-Atherogen; Anti-Krebs; Antibakteriell; Antiherpetisch; Antioxidant; Antiseptisch; Antituberkulös; Antiviral; Aphrodisiakum; Appetitanregend; Augenmittel; Bandwürmer tötend; Bandwürmer; Blutung stillend; Blutzuckersenkend; CNS-Anregend und Wachmacher; Cholesterinspiegelsenkend; Entwässernd; Fetteinlagernd; Fiebersenkend; Fungizid; Gebärmutterkräftigend, Stärkend; Herzstärkend; Hämolytisch; Magenstärkend; Menstruationsfördernd; Mundfäule; Nematizid; Parasiten abtötend; Schmerzlindernd; Verhütungsmittel; Weichtiertötend; Wurmmittel; Zellschädigend; Zusammenziehend;
Indikation:
Abdominalkrebs; Afterkrebs; Akne; Amygdalosis; Amöben; Appetitlosigkeit; Arteriosklerose; Asthma; Augenentzündungen; Ausfluss; Bakterien; Bakterienruhr; Bandwürmer; Bauchschmerzen oder Leibschmerzen; Blut im Urin; Bluthusten; Blutsturz; Blutungen; Bronchitis; Brustknoten; Cholera; Darmentzündungen; Dermatosen; Diabetes; Schmerzen; Durchfall; Endometriosis; Entbindung; Entzündliche Darmerkrankungen; Entzündungen; Erbrechen; Fieber; Flechten; Gallenprobleme; Gaumenzäpfchenkrebs; Gebärmutterentzündung; Gebärmutterkrebs; Gehirnentzündung; Gelbsucht; Genitalkrebs; Gonorrhoe; Halskrebs; Halsschmerzen; Hepatose; Herpes; Herzentzündungen; Herzkrankheiten; Hoher Cholesterolspiegel; Husten; Hyperglykämie; Hämophilie; Hämorriden; Hühneraugen; Infektion; Keratose; Kolik; Kondylom; Krebs; Krätze; Lungenentzündung; Lähmungen; Magenerkrankungen; Magenkrebs; Magersucht; Malaria; Melanom; Menstruationsbeschwerden; Metrorrhagie; Mundfäule; Mundkrebs; Nachtschweiß; Nagelbettentzündung; Nasenbluten; Nasenkatarrh; Neurosen; Ohrenkrebs; Ohrenschmerzen; Oxyuriasis; Parasiten; Pilze; Pilzinfektionen; Proctosis; Prolapsus; Psychosen; Pterygia; Ruhr; Salmonellen; Scheidenprobleme; Schlangenbisse; Schmerzen; Splenose; Unfruchtbarkeit; Uvulosis; Venenentzündungen; Verbrennungen; Verdauungsstörungen; Verstärkte Regelblutungen; Virus; Warzen; Wassereinlagerungen; Wundstellen; Würmer; Zahnfleischentzündungen; Zahnfleischkrebs; Übelkeit und Brechreiz;
Dosierung:
Früchte sind Nahrungsmedizin;
4–8 g gemahlene Frucht;
5–20 g Rinde;
20 g Rindensaft als Einzeldosis gegen Würmer.
1–2 g Rinde täglich;
5–12 g Rinde (Wurzelrinde oder Stammrinde) in 240 cm³ Wasser kochen und bis auf 1/3 reduzieren, alle 3 Stunden auf leeren Magen 2 Stunden nach Einnahme von 40 ml Rizinusöl;
250 Teile gemahlene Rinde in 1500 Teile Wasser und 30 Minuten kochen;
4–5 g gemahlene Blüten;
7 g Blüten/300 ml Wasser gegen Mundentzündung und Halsentzündung;
1–3 g gemahlene Wurzel;
1–3 g pulverisierte Samenschalen;
1 Teil Fruchtschale, Wurzel oder Stammschale: 5 Teile Wasser.
7 g Blüten in 300 ml Wasser bei Mundentzündung und Halsentzündung.
In der Homöopathie: dil. D 1-3.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Nicht bei Durchfall, nicht mit Fetten oder Ölen einnehmen, wenn Parasiten getötet werden sollen. Starke Dosen können zum Brechen reizen. Stärkere Dosen (> 80 g) können zu Schüttelfrost, Kollaps, Schwindel, Bluterbrechen und Sehstörungen, vielleicht sogar zu Erblindung und Tod führen.
Nicht für Säuglinge, Kinder und in Schwangerschaft und Stillzeit.
Speisewert:
Medizinisch
5 Bild(er) für diese Pflanze
Abmessungen:
Frucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher
Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher  Stacheln an Stamm oder Blatt
Stacheln an Stamm oder Blatt Blütezeit
Pflanze Jährigkeit
 Mehrjährig
MehrjährigHaare
Blätter
 Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)
Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)  Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen  Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind)
Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind) Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand ein Büschel, einfach und monopodial
Blütenstand ein Büschel, einfach und monopodial Blüten
 bisexuell
bisexuell  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  Blütenboden vergrössert, ganz oder teilweise frei vom Fruchtknoten
Blütenboden vergrössert, ganz oder teilweise frei vom Fruchtknoten  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter mehr als 5
Kelchblätter mehr als 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt
Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt  Blütenblätter 5
Blütenblätter 5  Blütenblätter 6
Blütenblätter 6  Blütenblätter 7
Blütenblätter 7  Blütenblätter alle frei voneinander
Blütenblätter alle frei voneinander  Blütenblätter schuppig
Blütenblätter schuppig  Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar
Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten mehr als 5-kammerig
Fruchknoten mehr als 5-kammerig  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Samenanlagen seitlich, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen seitlich, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt Früchte
 Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)
Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Keim gekrümmt
Keim gekrümmt  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe Verbreitung
 Asien
Asien  Europa
Europa