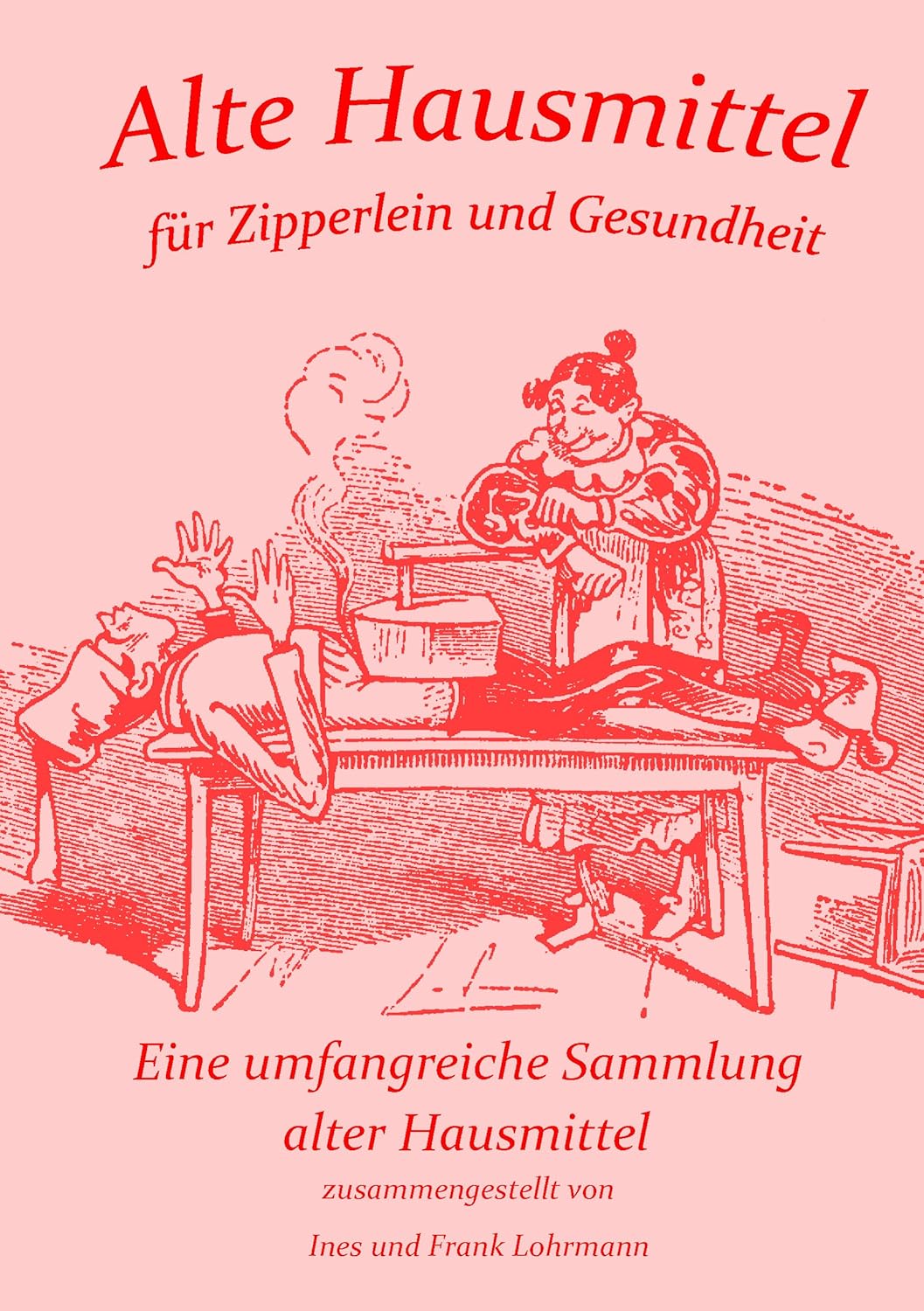Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Home > Tracheophyta > Magnoliopsida > Caryophyllales > Caryophyllaceae > Saponaria > Gewöhnliches Seifenkraut
Gewöhnliches Seifenkraut - Saponaria officinalis L.
Englisch: Boston pink, Bouncing-bet, Bouncing-Bett, Bouncing Bess, bouncing Bet, Bouncingbet, Bouncingbet Soapweed, Bruise-wort, bruise wort, Bruisewort, Bruse-wort, Burit, Buryt, Chimney pink, Chimney pinks, Common soapwort, Crow-soap, Crow soap, Double Bouncing Bet, Flop-top, Floptop, fuller's herb, Full ers grasse, Fuller’s-herb, Fuller’s grass, Fuller’s herb, Hedge-pink, Hedge pink, Herbe phylyp, Lady by-the-gate, Lady by the gate, Latherwort, London-pride, London pride, Mock gilliflower, Mock gillyflower, Monthly pink, Officinal soap-wort, Officinal soap wort, Old-maid’s pink, Old maid pink, Old maid’s pink, Sap onaria, Saponary, Scourweed, Scourwort, Sheep-weed, Sheep weed, Soap-root, Soap-wort, Soap root, Soaproot, Soapweed, Soapwort, Soapwort-gentian, Soapwort gentian, Sope-wort, Sope woort, Sweet Bettie, Sweet Betties, Sweet Betty, Såpnejlika, Wild Sweet-William, Wild Sweet William, Wood phlox, Woods phlox, World’s-wonder, World’s wonder
Französisch: Saponaire savoniere, Savonnière
Spanisch: Saponaria
Russisch: мыльнянка лекарственная
China: 月巴皂草 féizàocào

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Echtes Seifenkraut
Echtes Seifenkraut
Eisenkraut
Eisenkraut
Gebräuchliches Seifenkraut
Gewöhnliches Seifenkraut
Rote Seifenwurzel
Rote Seifenwurzel
Seifenwurz
Seifenwürze
Speichelwurz
Wachwurz
Waschkraut
Waschkraut
Waschwurz
Waschwurzel
Synonyme :
Bootia saponaria Neck.
Bootia vulgaris Neck.
Lychnis officinalis (L.) Scop.
Lychnis saponaria (Neck.) Jess.
Lychnis saponaria Jessen
Sabulina hybrida (L.) Rchb.
Saponaria alluvionalis C.Du Moulin
Saponaria hybrida Mill.
Saponaria nervosa Gilib.
Saponaria officinalis f. abnormis Zapal.
Saponaria officinalis f. glaberrima (Ser.) Hegi
Saponaria officinalis f. macropetala Zapal.
Saponaria officinalis f. pleniflora (Schur) Zapal.
Saponaria officinalis f. tenuifolia Zapal.
Saponaria officinalis var. alluvionalis (C.Du Moulin) Prantl
Saponaria officinalis var. glaberrima Ser.
Saponaria officinalis var. hortensis H.Mart.
Saponaria officinalis var. hybrida L.
Saponaria officinalis var. parvilimbis Zapal.
Saponaria officinalis var. puberula Syme
Saponaria officinalis var. puberula Syme ex Rouy & Foucaud
Saponaria officinarum Rupr.
Saponaria vulgaris Pall.
Silene saponaria (Neck.) Fr.
Silene saponaria Fr. ex Willk. & Lange
Stengel bzw. Stamm: besitzt eine stark verzweigte, ausläuferartig weithin kriechende Grundachse. Die feinflaumigen Stengel werden 30—70 cm hoch. Sie sind im oberen Teil etwas ästig und tragen gekreuzt gegenständige Blätter, die länglich-lanzettlich, zugespitzt und dreinervig sind. In den Achseln der Blätter stehen unten einzeln, oben zu drei bis fünf die großen hell fleischfarbenen Blüten.
Blüte: In den Achseln der Blätter stehen unten einzeln, oben zu drei bis fünf die großen hell fleischfarbenen Blüten, Der fünfzähnige Kelch ist walzenförmig. Die fünf Kronenblätter sind lang benagelt. Am Grunde der Platte bilden zwei spitze, weiße Zähnchen das Krönchen. Die Blüte hat zehn Staubgefäße und einen oberständigen Fruchtknoten. Die vorstäubenden Blüten, die abends am stärksten duften, werden vornehmlich von Abend- und Nachtschmetterlingen besucht. Blütezeit: Juli bis September.
Frucht bzw. Samen: eine vierzähnige aufspringende Kapsel.
Vorkommen: Das im Mittelmeergebiet heimische Kraut ist heute weit über Eurasien verbreitet und auch in Nordamerika eingeschleppt. An Mauern, Zäunen und Flußufern, auf Feldern und Dungplätzen ist es häufig anzutreffen.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Wurde früher als Seifenpflanze angebaut, sie diente als Waschmittel, sie dient zur Herstellung von Fleckenwasser und Mitteln zur Regeneration von Kunstgegenständen, z.B. Wollteppichen und Seidenteppichen.
Medizinisch:
Der Gebrauch geht auf die arabischen Ärzte zurück, welche sie gegen Lepra, Flechten und bösartige Geschwüre verschrieben.
Medizinisch verwendet werden die getrockneten Wurzeln bzw. Rhizome, manchmal auch das oberirdische Kraut, traditionell eingesetzt als Hustenlöser bei Husten und Lungenproblemen.
In der Volksmedizin dient das Kraut der Behandlung von Brustleiden und Lungenerkrankungen wie Katarrh und Husten sowie von Rheuma.
Die Wurzel dient als Mittel zum Abhusten bei Katarrh der Luftwege, in der Volksmedizin auch bei Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen, Gallenerkrankungen, Rheuma und chronischen Hauterkrankungen sowie als Mittel zur Förderung der Menstruation.
In China wird sie besonders bei Abszessen, Furunkeln, Geschwüren, Krätze, Mastitis, Lymphangites, zur Behandlung von Syphilis, Drüsenleiden und chronischen Hauterkrankungen verwendet.
Die Pflanze enthält in Samen und Wurzel einen hohen Anteil an Saporin. Die Samen dienen der Saponin-Gewinnung.
Inhaltsstoffe des Krauts sind Triterpensaponine, Flavonoide und Pyranglykoside.
Die Wurzeln enthalten Triterpensaponine (Quillajasäure, Gypsogenin, Gypsogensäure), Polysaccaride (alpha-L-Arabinse, beta-D-Fructose, beta-D-Galactose, beta-D-Glucose, beta-D-Glucuronsäure, Rhamnose und Xylose.
In Studien wurde das enthaltene Saporin zur Behandlung von Tumoren getestet, von dem man sich zukünftiges Potential verspricht.
Die enthaltenen Saponine können immunstimulierende Komplexe bilden, die in der Lage sind, innerhalb von Vakzinen einen adjuvanten Effekt auszuüben.
Aktivität:
Abführend; Antiseptisch; Aphrodisiakum; Brechreizend; Cholesterinspiegelsenkend; Detergent; Entwässernd; Entzündungshemmend; Galle treibend; Menstruationsfördernd; Reinigend; Reizerregend; Schleimlösend, Hustenlöser; Schleimlösend; Schmerzlindernd; Schweißtreibend; Spermien abtötend; Stimmungsverändernd; Zellschädigend;
Indikation:
Abszesse; Akne; Angina; Arthrose; Asthma; Ausfluss; Bakterien; Beulen Vereiterungen und Furunkel; Blutandrang; Bronchitis; Cervicosis; Darmentzündungen; Depression; Dermatosen; Schmerzen; Durchfall; Ekzeme und Neurodermitis; Entzündungen; Erkältungen; Escherichia; Exanthem; Fieber; Furunkel; Gallenblasenentzündung; Gebärmutterhalskrebs; Gelbsucht; Geschwüre; Gewebeverhärtung; Gicht; Giftsumach -Vergiftung; Glossitis; Halsdrüsengeschwulst; Hautausschlag; Hepatose; Hoher Cholesterolspiegel; Husten; Hypochondrie; Infektion; Katarrh; Kehlkopfentzündung; Keuchhusten; Krätze; Lichen; Lymphangitis; Magenerkrankungen; Mandelentzündung; Mastitis; Menstruationsbeschwerden; Milzkrebs; Nasenkatarrh; Nervenschwäche; Oxyuriasis; Pilzinfektionen; Psychosen; Rachenentzündung; Rheumatismus; Schleimhautentzündungen; Schmerzen; Schuppenflechte; Splenose; Staphylococcus; Syphilis; Venenentzündungen; Verstopfung; Wassereinlagerungen; Wassersucht; Wunden;
Dosierung:
1,5 g Wurzel /Tag;
1 Teelöffel Wurzel in abgekühltem Tee;
0,4–1,5 g Rinde/Tag;
0,4 g/Tasse Rinde Tee;
1–2 g Rindenextrakt.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Selten Magen-Reizungen. Große Dosen können giftig sein. Saporine sind hämolytisch . Kann Schleimhäute und Haut reizen. Kann Erbrechen und Durchfall auslösen. Nicht bei GI-Problemen und Geschwüren. Nicht in der Schwangerschaft verwenden.
eschwüren.
Speisewert:
Medizinisch
3 Bild(er) für diese Pflanze
Saponaria officinalis © José María Escolano @ flickr.com |
Saponaria officinalis © José María Escolano @ flickr.com |
Saponaria officinalis © José María Escolano @ flickr.com |
Abmessungen:
Pflanze Höhe : 30.00 ... 80.00 cm xFrucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher  Stacheln an Stamm oder Blatt
Stacheln an Stamm oder Blatt Blütezeit
 Blütezeit Juni - 06
Blütezeit Juni - 06 Blütezeit Juli - 07
Blütezeit Juli - 07  Blütezeit August - 08
Blütezeit August - 08  Blütezeit September - 09
Blütezeit September - 09  Blütezeit Oktober - 10
Blütezeit Oktober - 10 Pflanze Jährigkeit
 Mehrjährig
MehrjährigHaare
 Haare drüsig, warzig
Haare drüsig, warzig  Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig
Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig  Haare verzweigt
Haare verzweigt Blätter
 Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)
Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)  Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Aderung in Längsblätter oder Teile (inkl. 3-teilige Blätter)
Aderung in Längsblätter oder Teile (inkl. 3-teilige Blätter)  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.
Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.  Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)
Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen  Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind)
Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind) Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)
Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 bisexuell
bisexuell  unisexual
unisexual  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)  Blütenboden vergrössert, konisch oder kalbkugelförmig (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden vergrössert, konisch oder kalbkugelförmig (oberständiger Fruchtknoten)  Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)
Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5  Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6  Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten
Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 4
Kelchblätter 4  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)
Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)  Kelchblätter schuppig oder verzerrt
Kelchblätter schuppig oder verzerrt  Blütenblätter 0 (inkl. Einem becherartigen Blütenkrone ohne Blätter)
Blütenblätter 0 (inkl. Einem becherartigen Blütenkrone ohne Blätter)  Blütenblätter 4
Blütenblätter 4  Blütenblätter 5
Blütenblätter 5  Blütenblätter alle frei voneinander
Blütenblätter alle frei voneinander  Blütenblätter schuppig
Blütenblätter schuppig  Corona vorhanden oder im Grunde Schuppig
Corona vorhanden oder im Grunde Schuppig  Staubbeutel 1, fruchtbar
Staubbeutel 1, fruchtbar  Staubbeutel 2, fruchtbar
Staubbeutel 2, fruchtbar  Staubbeutel 3, fruchtbar
Staubbeutel 3, fruchtbar  Staubbeutel 4, fruchtbar
Staubbeutel 4, fruchtbar  Staubbeutel 5, fruchtbar
Staubbeutel 5, fruchtbar  Staubbeutel 8, fruchtbar
Staubbeutel 8, fruchtbar  Staubbeutel 10, fruchtbar
Staubbeutel 10, fruchtbar  Blüte obidiplostemonous, doppelt so viel Staubblätter als Blütenblätter
Blüte obidiplostemonous, doppelt so viel Staubblätter als Blütenblätter  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel
Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel  Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)
Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)  Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)
Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  2 Samen pro Fruchtkammer
2 Samen pro Fruchtkammer  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)
Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)  Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)
Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)  Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)
Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)  Frucht hat 1 Samen
Frucht hat 1 Samen  Frucht hat 2 Samen
Frucht hat 2 Samen  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Samen mit Flügeln
Samen mit Flügeln  Samen mit Haaren
Samen mit Haaren  Samenmantel oder mantelähnliche Organe vorhanden
Samenmantel oder mantelähnliche Organe vorhanden  Keim gerade
Keim gerade  Keim gekrümmt
Keim gekrümmt  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Europa
Europa  Previous
Previous