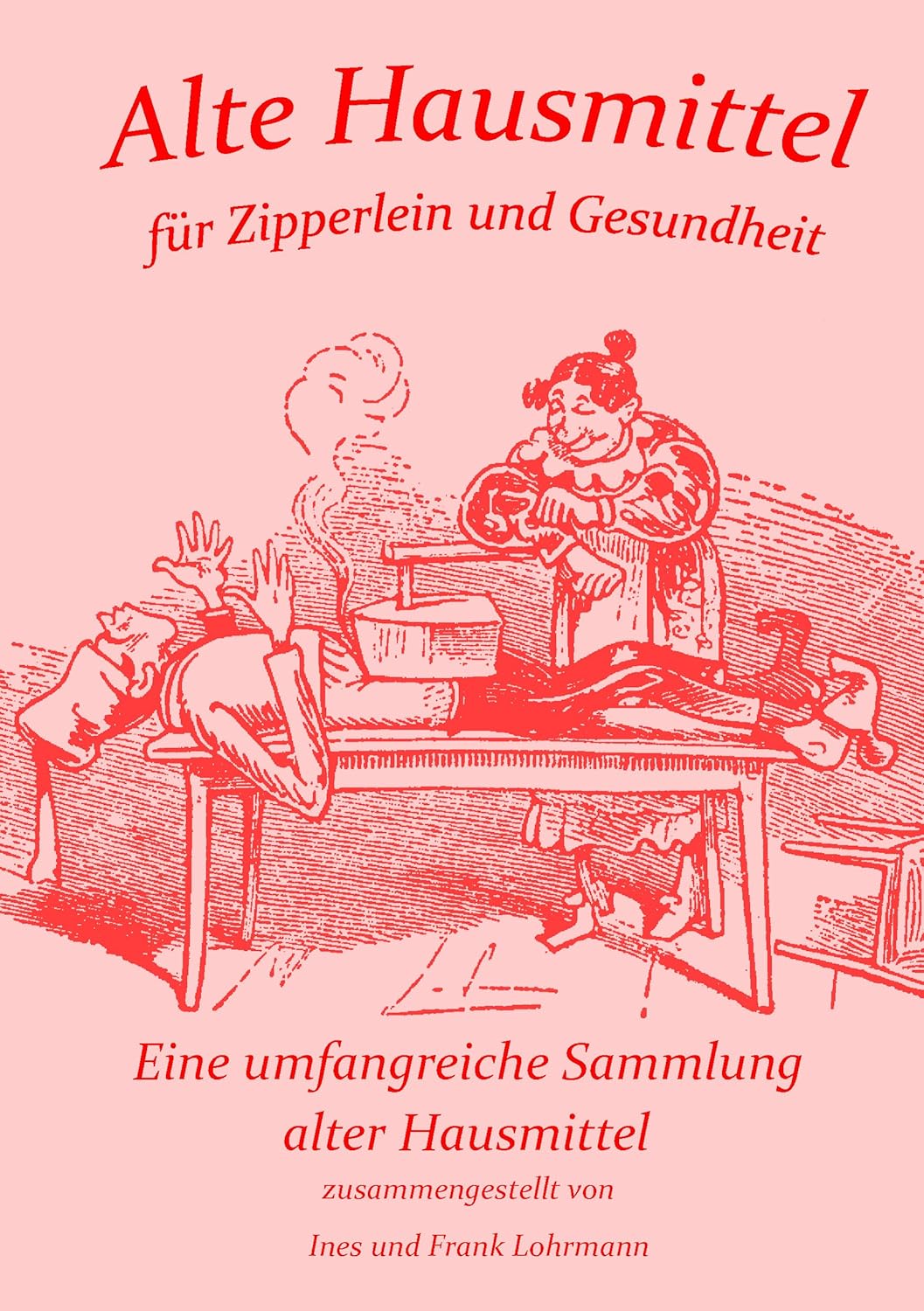Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Floh-Knöterich - Persicaria maculosa Gray
Englisch: Black-heart, Blackheart, Black heart, common knotweed, Common persicary, Heart'S-Ease, Heartweed, Heart’s, Heart’s-ease, Jesus plant, Jesusplant, Lady's-thumb, Lady's- thumb, Lady'S-Thumb Smartweed, Lady's Thumb, Persicaria, Red Leg, Redleg, Red shank, Redshank, Smartweed, Spotted knotweed, Spotted Lady's-thumb, Spotted Lady'S Thumb, Spotted Ladysthumb, Spotted smartweed, Willow Weed

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Bitterling
Brennender Knöterich
Floh Knöterich
Floh-Knöterich
Flohknöterich
Flohpfeffer
Pfefferiger Knöterich
Pfefferknöterich
Pfefferkraut
Pfirsichblättriger Knöterich
Ruttich
Scharfer Knöterich
Scharfkraut
Wasserpfeffer
Wasserpfeffer-Knöterich
Synonyme :
Persicaria fallax Greene
Persicaria granulata Greene
Persicaria lorinseri Opiz
Persicaria maculata (Raf.) Fourr.
Persicaria maculosa var. angustifolium Beckh.
Persicaria maculosa var. argentea Gray
Persicaria pulicariodes Montandon
Persicaria vulgaris Samp.
Polygonum agreste Fr.
Polygonum albescens Gand.
Polygonum arnassense Gand.
Polygonum benearnense Gand.
Polygonum camptocladum Gand.
Polygonum caniusculum Gand.
Polygonum debilius Gand.
Polygonum dubium Stein
Polygonum elatiusculum Gand.
Polygonum erythrocladum Gand.
Polygonum fallax Greene
Polygonum hirtovaginum Gand.
Polygonum humifixum Gand.
Polygonum ilophilum Gand.
Polygonum intermixtum Gand.
Polygonum interruptellum Gand.
Polygonum lacunosum Gand.
Polygonum lamellosum Gand.
Polygonum leucanthemum Gand.
Polygonum longipilum Gand.
Polygonum lorinseri Opiz
Polygonum lugdunense Gand.
Polygonum maculatum Dulac
Polygonum millepunctatum Gand.
Polygonum minus subsp. subcontinuum (Meisn.) Fern.
Polygonum nisus Gand.
Polygonum orthocladum Gand.
Polygonum ovatolanceolatum Gand.
Polygonum pallidiflorum Gand.
Polygonum persicaria f. albiflorum Millsp.
Polygonum persicaria f. humile S.X.Li & Y.L.Chang
Polygonum persicaria f. latifolium S.X.Li & Y.L.Chang
Polygonum persicaria subsp. rechingeri (Sennen) Sennen
Polygonum persicaria var. angustifolium Beckh.
Polygonum persicaria var. minus Hook.
Polygonum persicaria var. persicaria
Polygonum praelongum Gand.
Polygonum punctatum Kitt.
Polygonum ramondianum Gand.
Polygonum rechingeri Sennen
Polygonum rhombaeum Gand.
Polygonum rubelliflorum Gand.
Polygonum rufescens Gand.
Polygonum serrulatum var. angustifolium Peter
Polygonum subcanum Gand.
Polygonum subsimplex Gand.
Blatt: Die Tuten am Grunde der Blätter sind kaum behaart und an
ihrem Rande mit Wimpern besetzt, welche kurz, höchstens halb
so lang wie die Tute sind. Blätter lanzettlich.
Stengel bzw. Stamm: Einjähriges, bis 60 cm hohes Kraut. Der ästige Stengel und die breitlanzettlichen Laubblätter sind oft rot überlaufen und haben einen scharfen, pfefferartigen Geschmack, der als Schutzmittel gegen Tierfraß gedeutet wird. Die drüsigen Sekretionsorgane, auf deren Tätigkeit wahrscheinlich der pfefferartige Geschmack beruht, befinden sich am Stengel und an den Laubblättern, die größten jedoch an den grünen oder rötlichen Blütenblättern.
Blütezeit: Juli
Blüte: Die Ähren sind fadenförmig, dünn und locker. Die Blüten haben 6 Staubblätter. Blüten grünlich, mit purpurnem oder weißem Rande. Selbstbestäubung unvermeidlich; es finden sich auch kleistogame Blüten.
Blütezeit: Juli bis September
Vorkommen: Gemäßigte Regionen der nördlichen Hemisphäre
häufig in Gräben, an feuchten Waldstellen und Teichen Europas und Nordamerikas anzutreffen. Die ganze Pflanze schmeckt pfefferartig, beißend scharf.
Geschmack: pfefferscharf
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Aus der Pflanze lässt sich mit Alaun als Beizmittel gelber Farbstoff gewinnen.
Genussmittel, Nahrungsmittel:
Samen: Mehl, Gebäck
Blätter: Salat, Gemüse, Spinat, in Salz u. Essig eingelegt
Blätter und junge Triebe werden roh oder gekocht gegessen, die Samen werden roh oder gekocht gegessen.
Getrocknetes und pulverisiertes Kraut als Pfefferersatz, besonders in Notzeiten.
Medizinisch:
Der schon im Altertum bekannte Wasserpfeffer wird von Dioskurides in Form von Kataplasmen als erweichendes Mittel und als Ersatz für Pfeffer bezeichnet. In den Kräuterbüchern des Mittelalters wird er zur Behandlung von eitrigen Wunden, von Fisteln und Feigwarzen, gegen die schwarzen Blätter und als Mittel gegen Ungeziefer genannt. Die Blätter sollen Fleisch vor Würmern bewahren. In der Tierheilkunde wurde das Mittel in Form von Umschlägen bei hartnäckigen Hautkrankheiten, fauligen und brandigen Geschwüren sowie zur Zerstörung von wildem Fleisch früher viel benutzt. Im Gegensatz zu der nur untergeordneten Bedeutung der Pflanze in der Volksheilkunde in Deutschland, spielt sie im Osten als Volksheilmittel eine große Rolle. So wird das zerstoßene Kraut an Stelle von Senfpflaster als schmerzstillender
Umschlag verwendet, ferner dient die Abkochung des Krautes gegen Hämorrhoiden und Krätze, als Gurgelwasser gegen Kehlkopferkrankungen, Geschwülste und Zahnschmerzen.
Die Blätter wirken adstringierend, harntreibend, hautreizend und wurmtreibend. Die Infusion diente der Behandlung von Magenschmerzen und Kies. Eine Abkochung von Mehl und der Pflanze diente als schmerzlindernder Umschlag. Die Abkochung der Pflanze wurde auch als Fußbad und Beinbad bei Rheuma verwendet. Die zerdrückten Blätter wurden auf den durch Gift-Efeu verursachten Ausschlag gerieben.
Enthält Gerbstoffe, Gallussäure, Flavonoglykoside, ätherische Öle, Eisen und andere Mineralien.
Aktivität:
Allergieerreger; Anregend und Wachmacher; Anti-Rheumatisch; Anti-Implantation; Antibakteriell; Antimutagen; Antiseptisch; Beruhigend; Blutdrucksenkend; Blutgefäßverengend; Blutung stillend; Empfängnisverhütend; Entwässernd; Fischgift; Gebärmutterkräftigend, Stärkend; Gegen Blähungen; Hautreizend; Insektenschutzmittel; Kapillarwände stärkend; Kräftigend, Stärkend; Larvizid und Larventötend; Menstruationsfördernd; Muskelrelaxans; Reizerregend; Schmerzlindernd; Schweißtreibend; Steinauflösend; Verhütungsmittel; Wurmmittel;
Indikation:
Aderschwäche; Erkältung; Angina; Arthrose; Asthma; Ausbleibende Menstruation; Ausfluss; Bakterien; Bauchfellkrebs; Blut im Urin; Bluthochdruck; Bluthusten; Blutsturz; Blutungen; Blähungen; Cholera; Darmentzündungen; Dermatosen; Schmerzen; Durchfall; Ekzeme Krätze und Juckreiz; Entzündungen; Erbrechen; Fibrome; Fieber; Fisteln; Fußkrebs; Gebärmutterentzündung; Gebärmutterkrebs; Gelbsucht; Geschwülste; Gewebeverhärtung; Gicht; Gonorrhoe; Grieß in Blase oder Niere; Harnblasenentzündungen; Harnstrenge; Husten; Hämorriden; Kolik; Kopfschmerzen; Krampfadern; Krebs; Krätze; Magenerkrankungen; Menstruationsbeschwerden; Metrorrhagie; Nagelbettentzündung; Nervosität und Unruhe; Prellungen und Blutergüsse; Psychosen; Rheumatismus; Ruhr; Schlafstörungen; Schlaganfall; Schleimhautentzündungen; Schmerzen; Steine; Strangurie; Verbrühungen; Verdauungsstörungen; Verstauchungen; Wassereinlagerungen; Wassersucht; Wundbrand; Wunden; Würmer; Zahnschmerzen; Ödeme;
Dosierung:
600–3750 mg Kraut Flüssigextrakt;
1 Teelöffel Kraut/Tasse Tee oder Wasser 3 ×/Tag.
innerlich: getrocknetes oder frisches Kraut zum Aufguss: 30g auf 1l Wasser, 10 Min. ziehen lassen (bei Hämorrhoiden oder Nierensteinen oder unregelmäßigen Menstruationsblutungen)
Äußerlich als Breiumschlag bei Bronchitis, Auflage auf Wunden.
In der Homöopathie: bis dil. D 2.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Pflanze ist potentiell allergen. Größere Mengen vom Kraut können Magen und Darm reizen.
Speisewert:
Medizinisch
1 Bild(er) für diese Pflanze
Persicaria maculosa © Anne Tanne @ Belgium |
Abmessungen:
Frucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
Blütezeit
Pflanze Jährigkeit
Haare
Blätter
Blütenstand
Blüten
Früchte
Verbreitung
 Asien
Asien  Europa
Europa  Nordamerika
Nordamerika  Previous
Previous