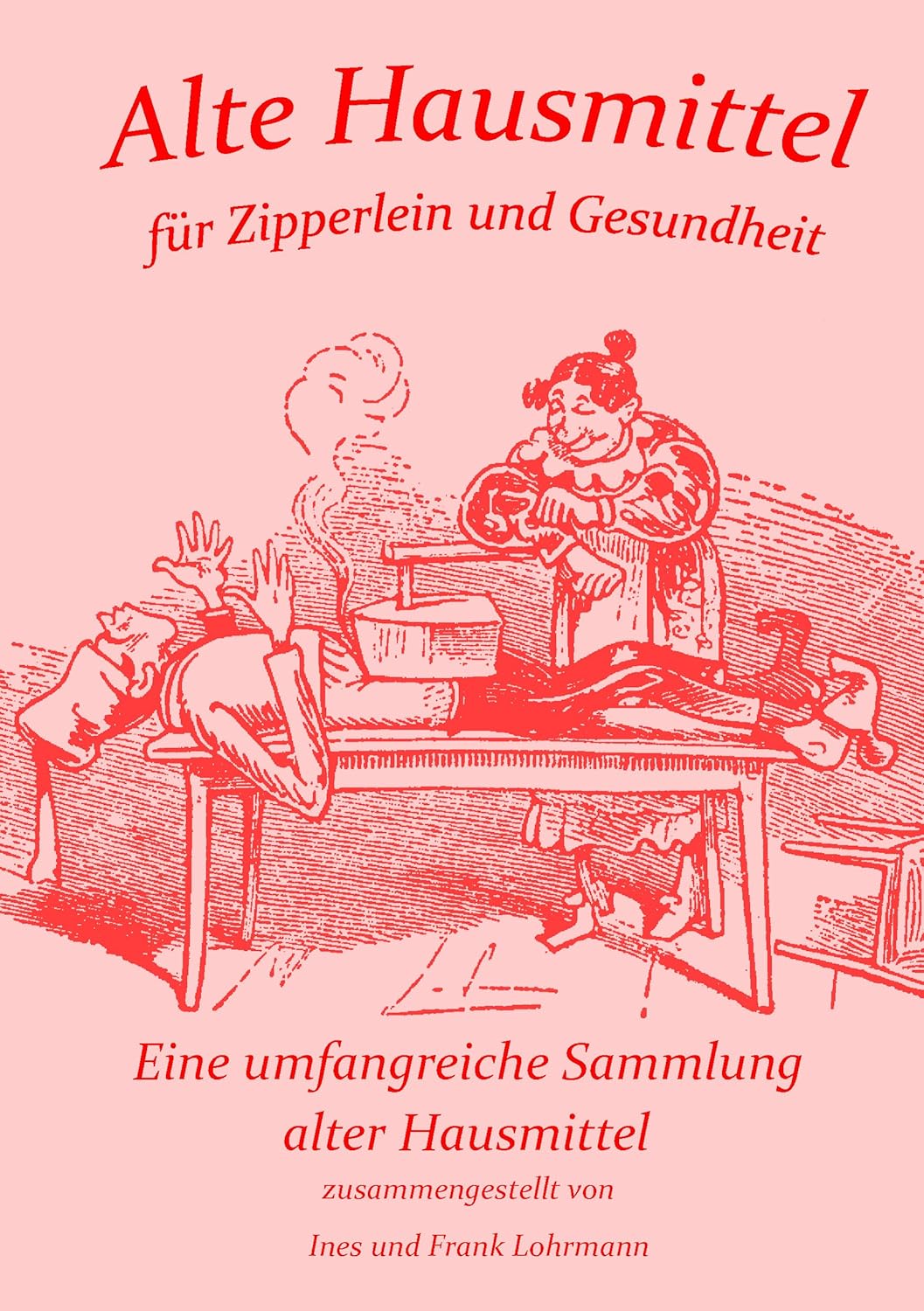Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Wermutkraut - Artemisia absinthium L.
Englisch: absinth, Absinthe, Absinthe Grande, Absinthe sagewort, Absinthe wormwood, absinthium, Absinth Sagewort, Absinth wormwood, Boy’s-love, Common-Wormwood, Common Sagewort, Common Wormwood, Insipid absinth, Lad'S Love, Madderwort, Maderwort, Mingwort, Mug-wort, Mugwoort, Mugwort, Old-woman, Old Man, Oldman wormwood, Old woman, warmot, Weremod, Worm-wood, Wormewood, Wormit, Wormwood, Wormwood [plant]
Portugiesisch: absinto, absíntio-comum, aluína, alvina, erva-dos-vermes, erva-santa, losna, losna-maior
Spanisch: ahenhus, ahinhus, ajenco, ajenco blanco, ajenjo, ajenjo común, Ajenjos, maestra, prodigiosa, Santa Lucía
Französisch: Aluyne
China: 洋艾 yáng'ài, 苦艾 kŭài
Russisch: полынь горькая

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Absinth
Alsem
Bitterer Beifuß
Echter Wermut
Gemeiner Wermuth
Wermut
Wermut-Tee
Wermuth-Beifuß
Wermutkraut
Wiegekraut
Wiegenkraut
Wurmkraut
Synonyme :
Absinthium bipedale Gilib.
Absinthium majus Garsault
Absinthium officinale Brot.
Absinthium vulgare (L.) Lam.
Absinthium vulgare Lam.
Artemisia absinthia St.-Lag.
Artemisia absinthium f. contracta Werner Christ.
Artemisia absinthium var. absinthium
Artemisia absinthium var. communis Braun-Blanq.
Artemisia absinthium var. insipida Stechm.
Artemisia absinthium var. inspida Stechm.
Artemisia albida Willd.
Artemisia albida Willd. ex Ledeb.
Artemisia arborescens f. rehan (Chiov.) Chiov.
Artemisia arborescens var. cupaniana Chiov.
Artemisia baldaccii Degen
Artemisia doonense Royle
Artemisia inodora Mill.
Artemisia pendula Salisb.
Artemisia rehan Chiov.
Artemisia rhaetica Brügger
Randblüten weiblich (nicht zwitterig). Blütenboden zottig (nicht nackt). Unterste Blätter zwei- bis dreifach-fiederschnittig.
Blatt: Unterste Blätter dreifach -fiederschnittig, mit lanzettlichen, stumpfen Fiederchen; obere einfacher, oberste ungeteilt, lanzettlich; alle beiderseits seidenhaarig, grünlich - weiss-grau.
Stengel bzw. Stamm: Stengel aufrecht. Höhe 60 bis 125 cm.
Blüte: Blüten hellgelb. Blütezeit Juli bis September.
Vorkommen: Heimat: gemäßigtes Europa, Asien, Nordafrika. In Nordamerika eingeführt.
An buschigen Abhängen und in Weinbergen; sehr zerstreut, bis 3500 m.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Genussmittel, Nahrungsmittel:
Blätter: in kleinen Mengen als Würze/Gewürz, Spirituosen, Likör, als Bierwürze, Ölaroma
Des aromatisch riechenden, bitteren, offizinellen Krautes, Herba Absynthii, halber auch angebaut und von da verwildert. Medizinalpflanze, Gewürz. Das Kraut wird bei Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden verwendet. Volksmedizin:
Die wichtigsten Anwendungen waren die als Wundmittel, gegen Cholera und Pest, Rheumatismus, Lähmungen, Gelbsucht, Wassersucht, Skorbut, Bleichsucht, Magenleiden, Frauenleiden, Epilepsie, Malaria usw. Sie diente zur Verhinderung des Rausches und war ein beliebtes Mittel gegen Katzenjammer. Die appetitanregende Eigenschaft der Pflanze hielt man für so groß, dass es genügte, die Blätter nur in die Schuhe zu legen, und darauf zu gehen, dass ,,die lust zur Speiß komme". Auch in der sympathetischen Medizin und als dämonenabwehrendes Mittel hat der Wermut, der als Bestandteil von Hexensalben und -tränken galt, im Volke eine gewisse Rolle gespielt. Die deutsche Volksmedizin verwendet den Wermut getreu den alten Überlieferungen bei atonischer Verdauungsschwäche, Magenkatarrh, Wechselfieber, als Emmenagogum, zur Austreibung der Plazenta und zur Förderung des Schlafes an, die Schweizer Kräuterkunde bei Abmagerung, Trunksucht und Seekrankheit, die amerikanische Medizin, als tonisches Stomachikum bei Dyspepsie. In der russischen Volksmedizin wird der Wermut als ganz vorzügliches, heilsames Hausmittel bezeichnet. Im Vordergrund steht die Wirkung bei Fieber und als Magenmittel sowie als Anthelmintikum. Man gab den Kindern die pulverisierten Blätter mit Honig, als spirituöse Auszüge und wässrige Infuse. Die Tinkturen wurden auch äußerlich zu Einreibungen benutzt. Weiter galt der Wermut als nützlich bei Gelbsucht, Hautparasiten und gegen Motten. Der Absinthschnaps wurde den Priestern, Mönchen und Nonnen dringend empfohlen, damit sie von schlechten Bedürfnissen des menschlichen Leibes befreit würden. Gegen Hautleiden aller Art das gepulverte frische Wermutkraut, mit einigen Tropfen Zitronensaft angefeuchtet, auflegen. Auch in der Veterinärheilkunde gilt der Wermut als gutes Mittel, das bei Fressunlust infolge von Verdauungsstörungen oder nach Krankheiten, bei Gelbsucht, Leberwürmern, Harthäutigkeit, besonders infolge chronischer Leberkrankheit, und bei überfütterungskoliken angewandt wird. Äußerlich wird er in Absudform gegen Krätze gebraucht. Die Verwendung des Absinthlikörs scheint erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich aus Algerien eingeführt worden zu sein. Der Absinthgenuß hatte sich besonders in den schweizerischen und französischen Großstädten rasch verbreitet. Infolge der ihm nachgesagten sehr schädlichen Wirkung (Schwindel, Muskelzuckungen, Krämpfe, Erbrechen, Bewußtlosigkeit, epilepsieähnliche Anfälle) setzte um 1900 eine lebhafte Bewegung zur Bekämpfung des Absinthismus ein, die zu einem völligen Verbot der Herstellung und Einfuhr in Deutschland, in der Schweiz, in Italien und Holland und zu einer Einschränkung von Anbau, Fabrikation und Konsum in Frankreich führten. Neuere Untersuchungen legen jedoch den Schluss nahe, dass die dem Absinth nachgesagten schädlichen Wirkungen mehr auf Grund der oft zur Färbung verwendeten Metallsalze geschuldet sind. In vielen Ländern ist Absinth nun wieder erhältlich, jedoch gibt es strenge Vorschriften über die im Absinth zulässigen Mengen Thujon. Das frische Kraut enthält bis 0,5% ätherisches Öl, dessen wichtigster Bestandteil das Absinthol = Thujon = Tanaceton = Salviol ist; daneben Thujylalkohol, Terpene und Sesquiterpene.
Medizinisch:
Das Kraut wird bei Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden verwendet. Die wichtigsten Anwendungen waren die als Wundmittel, gegen Cholera und Pest, Rheumatismus, Lähmungen,
Gelbsucht, Wassersucht, Skorbut, Bleichsucht, Magenleiden, Frauenleiden, Epilepsie, Malaria usw.
Sie diente zur Verhinderung des Rausches und war ein beliebtes Mittel gegen Katzenjammer. Die appetitanregende Eigenschaft der Pflanze hielt man für so groß, dass es genügte, die Blätter nur in die Schuhe zu legen, und darauf zu gehen, dass „die lust zur Speiß“ komme. Auch in der sympathetischen Medizin und als dämonenabwehrendes Mittel hat der Wermut, der als Bestandteil von Hexensalben und -tränken galt, im Volke eine gewisse Rolle gespielt.
Die deutsche Volksmedizin verwendet den Wermut bei atonischer Verdauungsschwäche, Magenkatarrh, Wechselfieber, als Emmenagogum, zur Austreibung der Plazenta und zur Förderung des Schlafes, die Schweizer Kräuterkunde bei Abmagerung, Trunksucht und Seekrankheit, die amerikanische Medizin, als tonisches Stomachikum bei Dyspepsie. In der russischen Volksmedizin wird der Wermut als ganz vorzügliches,
heilsames Hausmittel bezeichnet. Im Vordergrund steht die Wirkung bei Fieber und als Magenmittel sowie als Anthelminthikum. Man gab den Kindern die pulverisierten Blätter mit Honig, als spirituöse Auszüge und wässrige Infuse. Die Tinkturen wurden auch äußerlich zu Einreibungen benutzt. Weiter galt der Wermut als nützlich bei Gelbsucht, Hautparasiten und gegen Motten. Der Absinthschnaps wurde den Priestern, Mönchen und Nonnen dringend empfohlen, damit sie von schlechten Bedürfnissen des menschlichen Leibes befreit würden. Gegen Hautleiden aller Art das gepulverte frische Wermutkraut, mit einigen Tropfen Zitronensaft angefeuchtet, auflegen. Auch in der Veterinärheilkunde gilt der Wermut als gutes Mittel, das bei
Fressunlust infolge von Verdauungsstörungen oder nach Krankheiten, bei Gelbsucht, Leberwürmern, Harthäutigkeit, besonders infolge chronischer Leberkrankheit, und bei Überfütterungskoliken angewandt wird. Äußerlich wird er in Absudform gegen Krätze gebraucht. Die Verwendung des Absinthlikörs scheint erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts
in Frankreich aus Algerien eingeführt worden zu sein. Der Absinthgenuß hatte sich besonders in den schweizerischen und französischen Großstädten rasch verbreitet. Infolge der ihm nachgesagten sehr schädlichen Wirkung (Schwindel, Muskelzuckungen, Krämpfe, Erbrechen, Bewusstlosigkeit, epilepsieähnliche Anfälle) setzte um 1900 eine lebhafte Bewegung zur Bekämpfung des Absinthismus ein, die zu einem
völligem Verbot der Herstellung und Einfuhr in Deutschland, in der Schweiz, in Italien und Holland und zu einer Einschränkung von Anbau, Fabrikation und Konsum in Frankreich führten. Neuere Untersuchungen legen jedoch den Schluss nahe, dass die dem Absinth nachgesagte schädliche Wirkung mehr auf Grund der oft zur Färbung verwendeten Metallsalze geschuldet sind, weshalb es durch diese zu Metallvergiftungen gekommen ist.
In vielen Ländern ist Absinth nun wieder erhältlich, jedoch gibt es strenge Vorschriften über die im Absinth zulässigen Mengen Thujon.
Das frische Kraut enthält bis 0,5% ätherisches Öl, dessen wichtigster Bestandteil das Absinthol = Thujon = Tanaceton = Salviol ist; daneben Thujylalkohol, Terpene und Sesquiterpene (alpha-Bisabolol, beta-Curcumen, Spathulenol), Sesquiterpenlacton-Bitterstoffe (Absinthin, Anabsinthin, Artabsin, Artabin, Matricin), Flavonolglycoside.
Das Kraut wirkt bei Magen-Darm-Beschwerden die Magensaftsekretion an und kommt auch bei Dyskinesien der Gallenwege zur Verwendung. Das Kraut wird in Magentees, Lebertees und Gallentees verwendet.
Aktivität:
Abtreibend; Anregend und Wachmacher; Anti-Nematoden; Antibakteriell; Antiseptisch; Aperitif; Beruhigend; Betäubend; Bitterstoff; CNS Depressant; Choleretikum; Discutient; Entzündungshemmend; Erweichend; Fiebersenkend; Flohmittel; Fungizid; Galle treibend; Gegen Blähungen; Giftig; Herzstärkend; Insektenschutzmittel; Insektizid; Krampflösend; Kräftigend, Stärkend; Leberstärkend; Magenstärkend; Menstruationsfördernd; Milchfluss steigernd; Plasmodistat; Reinigend; Schmerzlindernd; Schweißtreibend; Sekretionsanregend; Speichelfluss erhöhend; Verdauungsfördernd; Verdauungsstärkend; Wundheilend, Wurmmittel;
Indikation:
Anämie; Appetitlosigkeit; Arthrose; Atmungsprobleme; Atonie; Ausbleibende Menstruation; Bakterien; Bauchschmerzen oder Leibschmerzen; Biliäre Dyskinesie; Blähungen; Brustkrebs; Brüche; Darmentzündungen; Dermatosen; Schmerzen; Durchfall; Ekzeme Krätze und Juckreiz; Entbindung; Entzündungen; Erkältung; Fieber; Fußkrebs; Gallenblasenentzündung; Gebärmutterkrebs; Gelbsucht; Gesichtskrebs; Gewebeverhärtung; Gicht; Grieß in Blase oder Niere; Grippe; Hepatose; Hodenentzündung; Hodenkrebs; Hornaugen; Infektion; Insektenstiche; Kehlkopfkrebs; Knochenhöhlenkrebs; Knochenkallus; Kolik; Gliederkrebs; Krebs; Krämpfe; Leberkrebs; Leukämie; Lymphdrüsenkrebs; Madenwurm; Magenerkrankungen; Magengeschwüre und Darmgeschwüre; Magenkrebs; Magersucht; Malaria; Menstruationsbeschwerden; Milz-Krebs; Muskelschwielen; Myosis; Nervenschmerzen; Nervosität und Unruhe; Parasiten; Pilze; Pilzinfektionen; Prellungen und Blutergüsse; Rheumatismus; Rundwürmer; Schlafstörungen; Schnupfen u; Sklerome; Splenose; Tuberkulose; Verdauungsstörungen; Verkühlungen; Verstauchungen; Wassersucht; Wunden; Würmer; Zungenkrebs; Ödeme;
Dosierung:
bis 1,5 g trockenes Kraut in Tee (1 Teelöffel = 1,5 g) 2–3 ×/Tag;
1–2 g trockenes Kraut;
1 Teelöffel Kraut/Tasse Wasser 1–3 ×/Tag, vor oder nach den Mahlzeiten;
2–3 g Kraut/Tag;
3–5 g Kraut;
1–2 ml flüssiger Krautextrakt;
4–16 ml Kraut Tinktur;
10–20 Tropfen Kraut Tinktur in Wasser 3 ×/Tag, vor den Mahlzeiten.
Das Kraut sollte nicht länger als eine Woche hintereinander verwendet werden.
In der Homöopathie: wenig gebräuchlich, dil. D 2-4, dreimal täglich
10 Tropfen.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Menstruationsfördernd und Wehenauslösend, Nicht für längeren Gebrauch bestimmt. Nicht überdosieren, nicht mehr als 4 aufeinander folgende Wochen nehmen.
Nicht bei Magengeschwür und Darmgeschwür. Hüten Sie sich vor der Toxizität von hohen Dosen. Nebenwirkungen durch Überdosierung von Thujon sind Gehirnschäden, Krämpfe, auch der Tod, Schlafstörungen, Darmkrämpfe, Übelkeit, Nierenschäden selten), Unruhe, Krampfanfälle, Magenkrämpfe, Zittern, Urinretention, Schwindel und Erbrechen.
Öl sollte nicht intern oder extern genutzt werden.
Nicht in Schwangerschaft und Stillzeit.
Wird Wermut in größeren Dosen verabreicht, so erzeugt es Vermehrung der Harn- und Schweißabsonderung, Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen; nach Missbrauch wurden Kongestionen, Kopfschmerzen, Schwindel, Geistesverwirrung und Betäubung beobachtet. Es kann auch zu tödlichen Vergiftungen kommen.
Speisewert:
Medizinisch
6 Bild(er) für diese Pflanze
Abmessungen:
Pflanze Höhe : 50.00 ... 130.00 cm xFrucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher Blütezeit
 Blütezeit Juli - 07
Blütezeit Juli - 07  Blütezeit August - 08
Blütezeit August - 08  Blütezeit September - 09
Blütezeit September - 09 Pflanze Jährigkeit
 Mehrjährig
MehrjährigHaare
Blätter
Blütenstand
Blüten
Früchte
Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Europa
Europa  Previous
Previous