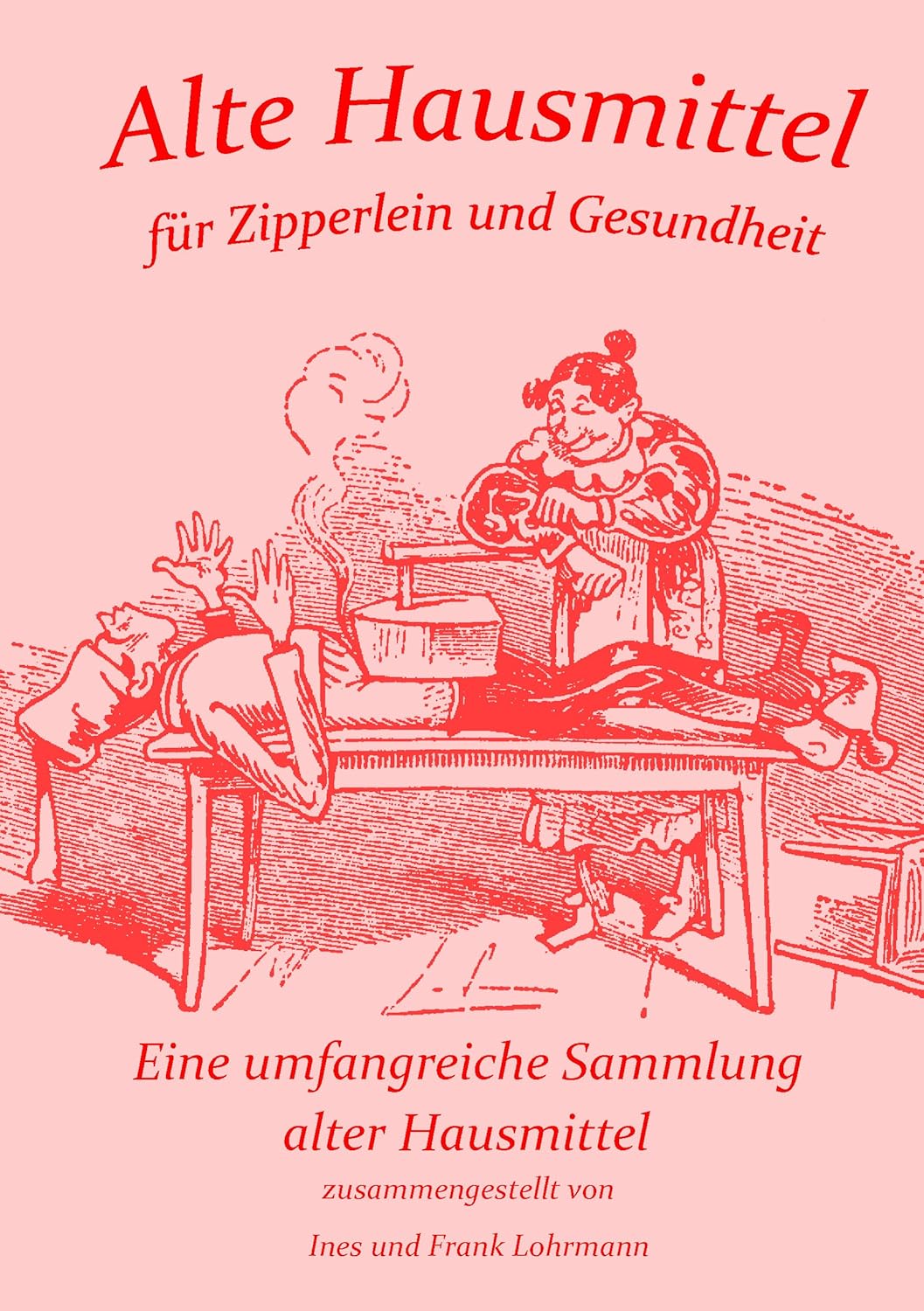Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Knoblauch - Allium sativum L.
Englisch: Ai, Allium, A̱gurma a̱nfwuong, Bhâbâng potè, Churles tryacle, Churl’s treacle, Clove garlic, Clown’s treacle, common garlic, crown‘s treacle, Cultivated Garlic, Garden Garlic, Garleac, garlic, Garlick, Garlicke, Garlyke, Hardneck Garlic, Kesuna, Kunofroku, Onion, Onions, poor-man‘s treacle, Poor-man’s-treacle, Poor-man’s treacle, Pskem River Garlic, Serpent Garlic, Tiskrt, Σκόρδον, Сарсмакъ, Чеснок, Սխտոր, వెల్లుల్లి, လသိုန်ဗတာင်
Portugiesisch: alho, alho-comum, alho-hortense, alho-manso
Spanisch: ajo
Französisch: Ail
China: 獨頭蒜 dútóusuàn, 蒜 suàn
Russisch: лук-чеснок, чеснок посевной

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Alterswurzel
Echter Knoblauch
Gartenlauch
Großer Schlangerknoblauch
Knob-Lauch
Knoblauch
Knoblech
Knoblig
Knofi
Perlzwiebel
Schlangen-Knoblauch
Stinkerzwiebel
Synonyme :
Allium arenarium Sadler ex Rchb.
Allium controversum Schrad. ex Willd.
Allium longicuspis Regel
Allium ophioscorodon Link
Allium pekinense Prokh.
Allium sativum f. asiae-mediae Kazakova
Allium sativum f. pekinense (Prokh.) Makino
Allium sativum f. sagittatum Kazakova
Allium sativum f. vulgare Kazakova
Allium sativum subsp. asiae-mediae Kazakova
Allium sativum subsp. controversum (Schrad. ex Willd.) K.Richt.
Allium sativum subsp. ophioscorodon (Link) Döll
Allium sativum subsp. ophioscorodon (Link) Schübl. & G.Martens
Allium sativum subsp. pekinense (Prokh.) F.Maek.
Allium sativum subsp. sagittatum
Allium sativum subsp. sativum
Allium sativum subsp. subrotundum (Gren. & Godr.) K.Richt.
Allium sativum subsp. vulgare
Allium sativum var. controversum (Schrad. ex Willd.) Nyman
Allium sativum var. controversum (Schrad. ex Willd.) Regel
Allium sativum var. ophioscorodon (Link) Döll
Allium sativum var. pekinense (Prokh.) F.Maek.
Allium sativum var. subrotundum Gren. & Godr.
Allium sativum var. vulgare Döll
Allium scorodoprasum subsp. viviparum (Regel) K.Richt.
Allium scorodoprasum var. multibulbillosum Y.N.Lee
Allium scorodoprasum var. viviparum Regel
Porrum ophioscorodon (Link) Rchb.
Porrum sativum (L.) Rchb.
Blatt: Blätter breit-lineal, spitz, lauchgrün, mit herabhängenden Spreiten, in der Knospe gefaltet.
Stengel bzw. Stamm: Dolde mit Brutzwiebelchen. Blätter flach. Nebenzwiebeln am Grunde des Schaftes länglich-eiförmig, weisslich, oft violett-purpurn überlaufen, sitzend, nebst der fast gleichgrossen Hauptzwiebel in weisse, häutige Schalen eingeschlossen. Hülle des Blütenstandes einklappig, in eine den fast kugeligen Kopf weit überragende, hinfällige Spitze ausgezogen. Höhe 30 bis 100 cm.
Blüte: Blütenhülle rötlich- bis schmutzig-weiss. Staubblätter kleiner als die Blütenhülle. Zähne der inneren Staubfäden kurz und stumpf, alle etwa gleichlang, küi-zer als das ungeteilte Stück des Staubfadens. Die Dolde besteht aus 25-30 eirunden Brutzwiebelchen, zwischen denen nur wenige kleine , langgestielte Blüten und häutige Deckblättchen stehen. Blütezeit Juli, August.
Vorkommen: Als Küchengewächs weltweit kultiviert und angebaut. Heimat ist ursprünglich Asien.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Knoblauch ist eine alte Kulturpflanze.
Schon in der altindischen Medizin gehörte der Knoblauch zu den geschätzten Arzneimitteln. Er wurde als umstimmendes Tonikum bei einer ganzen Reihe von Krankheiten genannt, so bei Hautleiden, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, Husten, Magerkeit, Rheumatismus, Unterleibsschmerzen, Milzvergrößerung, Hämorrhoiden usw.
Auch im alten Ägypten hat der Knoblauch eine große Rolle gespielt. Auch bei den Römern und Griechen wurde der Knoblauch als Gewürz gebraucht. Es wird berichtet, dass der Knoblauch im Altertum den Soldaten als Mittel galt, sich zu kräftigen und den Mut zu erhöhen. In Deutschland muss er schon lange vor Besitzergreifung Galliens und Germaniens durch die Römer bekannt gewesen sein, wofür die Bezeichnung Lauch als ein gemeingermanisches Wort spricht. In der Sage König Olafs des Heiligen wird (sinngemäß) berichtet:
„Nach der Schlacht bei Stiklarstadi am 31. August 1030 begaben sich einige verwundeten Krieger zu einer in der Nähe wohnenden
heilkundigen Frau, um sich von ihr die Wunden verbinden zu lassen. Nachdem sie die Wunden gereinigt hatte, gab sie ihnen Knoblauch und andere Kräuter zu essen, um durch den Lauchgeruch zu erkennen, ob die Wunde in den Unterleib eingedrungen sei oder nicht. "
Wie die meisten Pflanzen, die einen starken Geruch haben, galt der Knoblauch als dämonenabwehrendes Mittel. So heißt es in
der älteren Edda im Liede von Sigrdrifa:
„Die Füllung segne vor Gefahr Dich zu schützen / Und lege Lauch in den Trank."
Extrakte aus Knoblauchzehen wirken insektizid.
Gewürz, Gemüse.
Medizinisch:
Weltweit wird Knoblauch auch in der Volksmedizin verwendet. In Afrika gelten sie als Mittel gegen Atemwegsinfektionen und Anthelminthikum, werden aber auch wie in Nigeria zur Behandlung von Hautkrankheiten oder im Tschad als Stärkungsmittel bei Diabetes und Bluthochdruck verwendet.
Der geringere Anteil an Herzerkrankungen in Italien und Spanien im Vergleich mit den USA wird teilweise dem höheren Konsum von Knoblauchprodukten in den Mittelmeerländern zugeschrieben.
Knoblauch wirkt antithrombozyt, hyplipidemisch und wird auch in der klinischen Praxis als Mittel gegen Bluthochdruck, degenerative Herzkrankheiten und Atherosclerose verwendet.
Inhaltsstoffe sind Allicin, Allistatin, Glucominol, neo-Allicin, Steroidale Saponine, Polysaccharide, Furostanole Saponine, Proto-Isoeruboside,
Diallylsulfid.
Enthält Allicin, das Antifungal und gegen Amöben wirkt. Weitere Bestandteile wirken antibakteriell, antifungal und gegen Protozoen. Für die antibiotischen Eigenschaften sind die enthaltenen schwefelhaltigen Verbindungen verantwortlich, die im ätherischen Öl enthalten sind, welches besonders in den Zwiebeln enthalten ist. Wird die Zwiebel zerkleinert, wandelt sich das Alliin in Allicin um, welches gegen Bakterien wirkt. Wirksam ist es besonders gegen Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Colynebacterium diphteriae, Eschericia-Bakterien, Beudomonas aemigikosa, Salmonellen, Shigella dysenteriae und Serrratia. Nach indischen Forschungen soll auch das Wachstum von Mycobacterium tuberculosis gehemmt werden, aber auch einige Pilze, besonders der Gattungen Trichophyton und Microsporon sowie Protozoen besonders Trichomonaden werden gehemmt. In China wird Knoblauch zur unterstützenden Therapie bei Amöbenruhr und Cryptococcus meningitis verwendet.
In Indien wird er unter dem Namen Lasunah und Rasonah auch in der Ayurveda verwendet.
Volksmedizin:
als Diuretikum, gegen Hämaturie, Wechselfieber, chronischen Bronchialkatarrh, Asthma, äußerlich gegen Parasiten, bei krebsigen Geschwüren.
Indische Volksmedizin: bei Engbrüstigkeit kocht man Knoblauch mit Wasser und Zucker zu einem dicken Saft zur teelöffelweisen Einnahme. Bei Cholera sollte das Mittel eigentlich in keinem Hause
fehlen. In einfachster Form soll man die Zwiebel zunächst essen lassen oder einen Alkoholauszug aus einer Mischung von 6 Löffeln Alpinia galanga (Thai-Ingwer), 5 LöffeIn Allium sativum und 2 Kinderlöffeln Küchensalz, welches durch vierzehntägiges
Stehen in der Sonne gewonnen ist, geben. Bei Gelbsucht, Fieber und
Wassersucht gibt man den Knoblauch in derselben Zubereitung wie bei Engbrüstigkeit. Weiter geben die Inder Knoblauch prophylaktisch bei Sumpffieber, und zwar solchen Personen, die in sumpfigen Gegenden arbeiten müssen. Besonders beachtenswert ist die vielseitige äußere Anwendung. Insektenstiche
werden mit einem Brei von Knoblauch, Salpeter, Essig oder Salz behandelt.
Blutunterlaufene Flecke verschwinden angeblich sehr schnell durch Auflegen eines Breis von Knoblauch und Honig. Eiternde Geschwüre, Hautschwären, Karfunkel, Schiefer und Splitter in der Haut behandelt man mit in Leinöl geröstetem Allium sativum. Auch der hartnäckigste Hautausschlag soll verschwinden, wenn
man ihn mit einem Brei behandelt von Knoblauch, Honig und sehr wenig Wasser. Bei Zahnschmerzen steckt man ein Stückchen Knoblauch in die Ohren. Bei Nagel-, Finger- und Zehenquetschung legt man einen Verband von zerstampften Knoblauchzwiebeln auf. Auch Pickel und Pusteln im Gesicht werden vertrieben durch Einreiben von Knoblauchsaft.
In der chinesischen Heilkunde wird der Knoblauch als Chia-suang bezeichnet. Die Verwendung ist der indischen ähnlich.
In der russischen Volksmedizin wird der Knoblauch besonders gern bei Schleimhusten angewendet, und zwar gibt man zerstoßenen Knoblauch mit Honig gemischt. Diese Mischung wird die ganze Nacht hindurch in einen Topf im heißen Ofen gehalten, und der darauf erhaltene Saft wird dem Kranken eingegeben. Bei sehr hartnäckigem, von Blut speien begleitetem Husten braucht man Knoblauch mit Prunus padus (Gewöhnliche Traubenkirsche) fein gestoßen und mit Honig gemischt. Äußerlich wandte man den Knoblauch mit Talg zu einer Salbe verrieben bei Angina und Keuchhusten an, indem man Hals und Brust einrieb.
Im Übrigen sind die Indikationen der russischen Volksmedizin die üblichen wie Cholera, Eingeweidewürmer usw.
Dem Knoblauch wird auch eine besondere Wirksamkeit gegen die Nebenwirkungen des Tabakrauchens und bei Arteriosklerose nachgesagt.
Verwendet wird der Knoblauch oft als Knoblauchsirup, der durch das Einlegen von zerstoßenen Knoblauchzehen in Zucker, Zuckersirup oder Honig hergestellt wird. Der Sirup wird 3-4x pro Tag eingenommen und gilt als schleimlösend. Bei Amöbenruhr und bakterieller Ruhr werden 5g Knoblauch in 100 ml Wasser aufgekocht, der Sud wird abgekühlt und bis zu 6x täglich ein Klistier von 70 ml des Suds gegeben.
Aktivität:
Androgen; Anti-Androgen; Anti-Atherogen; Cholesterinsenker; Anti-Krebs; Anti-Rheumatisch; Antiaflatoxin; Antiaggregant; Amöbenzerstörend; Antiallergisch; Antiatherosklerotisch; Antibakteriell; Antidiabetisch; Anti-Giardiasis; Antiintegrase; Antimykotisch; Antioxidant; Antiseptisch; Antistress; Antitumor; Antiviral; Aphrodisiakum; Appetitanregend; Arthritis; Beruhigend; Blutdrucksenkend; Blutverdünnend; Blutzuckersenkend; Choleretikum; Cholesterinspiegelsenkend; Reizmittel - Entzündungen oder Ödeme hervorrufend; Entgiftend; Entwässernd; Entzündungshemmend; Fett abbauend; Fibrinolytika; Fiebersenkend; Fungizid; Gefäßerweiternd; Gegen Blähungen; Gegen Schilddrüsenüberfunktion; Gegenmittel bei Vergiftungen; Geschwürvorbeugend; Glutathion-stärkend; Hautreizend; Herzstärkend; Hypoperistaltisch; Hypourikämisch; Immunstimulans; Insektenschutzmittel; Insulin-sparend; Interleukine beeinflussend; Krampflösend; Kräftigend, Stärkend; Larvizid bzw. Larventötend; Leberstärkend; Lipide- und Lipoproteine senkend; Lymphozytose beeinflussend; Menstruationsfördernd; Mundfäule; Muskelkontrahierend; Muskelrelaxans; NKC-Enhancer; Antigenisch; Nervenstärkend; Ovizid; Parasiten abtötend; Phagozytierend; Prostagladinhemmer; Protisten verringernd; Schleimhaut abschwellend; Schleimlösend, Hustenlöser; Schmerzlindernd; Schutz vor Infektionen oder Giften; Schweißtreibend; Spermien abtötend; Stimmungsverändernd; Tick; Verdauungsfördernd; Verdauungstrakt stärkend; Verhütungsmittel; Wehenanregend; Wundheilend; Wurmmittel; Antihyperglykämisch; Östrogenwirkend;
Indikation:
Abdominalkrebs; Abszess; Akne; Allergie; Altersgebrechen; Amöben; Amöbiasis; Anämie; Aphten; Appetitlosigkeit; Arteriosklerose; Arthrose; Asthma; Atemnot; Ausfluss; Aussatz; Bacillus; Bakterien; Bakterienruhr; Bandwürmer; Bauchschmerzen oder Leibschmerzen; Beulen Vereiterungen und Furunkel; Bisse; Blasenkrebs; Blinddarmentzündung; Blutandrang; Bluthochdruck; Blähungen; Bronchiektasie; Bronchitis; Candida; Cholera; Chronische Abgeschlagenheit; Coccidiose; Colosis; Cryptococcus; Cytomegalovirus; Darmentzündungen; Darmkrebs; Debilität; Demenz; Dermatosen; Diabetes; Diphtherie; Schmerzen; Drüsenkrebs; Durchfall; Durst; Ohrenschmerzen; Entbindung; Entzündliche Darmerkrankungen; Entzündungen; Epigastrische Schmerzen; Epilepsie; Erkältungen; Escherichia; Fettleibigkeit; Fieber; Filaria; Flechten; Fußpilz; Gallenblasenentzündung; Gebärmutterkrebs; Geisteskrankheit; Geschwülste; Geschwüre; Gewebeverhärtung; Giardiasis; Gicht; Grippe; HIV; Haarausfall; Hakenwürmer; Halsschmerzen; Harnblasenentzündungen; Hautkrebs; Hefeinfektionen; Helicobacter; Hepatose; Herpes; Herzkrankheiten; Herzrasen; Hexenschuss; Hohe Triglyceridwerte; Hoher Cholesterolspiegel; Hornaugen; Husten; Hyperglykämie; Hyperlipidämie; Hyperperistaltik; Hypoglykämie; Hypotension; Hysterie; Hämorriden; Höhenkrankheit; Hörprobleme; Immunodepression; Immunosuppression; Impotenz; Infektion; Ischias; Karies; Katarrh; Kehlkopfentzündung; Keratose; Keuchhusten; Knochenhautentzündung; Knochenkallus; Kolik; Kopfschmerzen; Krampfadern; Krebs; Krämpfe; Krätze; Bleivergiftung; Leishmaniose; Leukämie; Lungenentzündung; Lungenkrebs; Lupus; Lymphdrüsenerkrankungen; Lymphoma; Lähmungen; Madenwurm; Magen-Darm-Entzündung; Magenerkrankungen; Magengeschwüre und Darmgeschwüre; Magenkrebs; Magersucht; Malaria; Mandelentzündung; Melancholie; Menopause; Menstruationsbeschwerden; Mundfäule; Muskelschmerzen; Muskelschwielen; Myofasciitis; Nagelbettentzündung; Nasenkatarrh; Nebenhöhlenentzündungen; Nervenschmerzen; Nervosität und Unruhe; Nicotinismus; Odontosis; Ohnmachtsanfälle; Paradentose; Parasiten; Paratyphus; Paratyphus; Pigmentstörungen; Pilze; Pilzinfektionen; Poliomyelitis; Polypen; Prostatakrebs; Psychosen; Pulposis; Rachenentzündung; Raynaud-Syndrom; Rheumatismus; Spulwurm; Ruhr; Räude; Salmonellen; Schlafstörungen; Schlangenbisse; Schleimhautentzündungen; Schmerzen; Schwerhörigkeit; Senile Demenz; Sepsis; Splenose; Sporotrichose; Staphylococcus; Streptococcus; Talgzysten; Thrombosen; Trachoma; Trichomoniasis; Trypanosomiasis; Tuberkulose; Tumor; Typhus; Ulcus cruris; Vaginose; Venenentzündungen; Verdauungsstörungen; Verstopfung; Virus; Warzen; Wassereinlagerungen; Wassersucht; Wundbrand; Wunden; Würmer; Zeitweise Klaudikation; Zuckungen; Zöliakie; Ödeme; Übelkeit und Brechreiz;
Dosierung:
9–15 g frische Knolle;
9 g trockene Knolle:45 ml Alkohol/45 ml Wasser;
1–5 Zehen/Tag; 2–4 g 3 ×/Tag;
4 g frische Knoblauch/Tag;
1,5–6 g frische Knolle;
2–4 ml Tinktur 1:5 in 45% Alkohol 3 ×/Tag;
0,03–0,12 ml Knoblauch-Öl/Tag;
1-2 Tropfen Öl
2–8 ml Knoblauchsirup;
2–4 ml Knoblauchsaft;
In der Homöopathie: dil. D 2-3, dreimal täglich 10 Tropfen..
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Einige chemische Verbindungen in Knoblauch, Zwiebeln, usw. können Brennen verursachen.
Mehr als 5 Zehen pro Tag kann Blähungen, Herzschmerzen und, bei Menschen die Blutverdünner zu sich nehmen, zu dünnes Blut verursachen. Kann die Wirkung von blutdrucksenkenden und gerinnungshemmenden Medikamente potenzieren.
Manche Menschen reagieren sehr allergisch auf Knoblauch. Kann selten GI-Störungen, allergische Reaktionen, Veränderung des Geruchs der Haut und Atem auslösen.
Durch Einatmen von Knoblauch-Pulver kann es zu Allergischen Reaktionen, Kontakt-Dermatosen und schweren Asthmaanfällen kommen. Auf der Haut kann Knoblauch oder Knoblauch-Öl lokale Reizwirkungen verursachen. Übelkeit und Brechreiz, Erbrechen, Durchfall kann nach der Einnahme der frischen Knoblauchknollen, Extrakte, oder Öl entstehen.
Sparsam bei Kindern unter 2 Jahren, kann Mund oder Magen reizen.
Speisewert:
Essbar, Nahrung
2 Bild(er) für diese Pflanze
Allium sativum © Arthur Chapman @ flickr.com |
Allium sativum © Anne Tanne @ Belgium |
Abmessungen:
Pflanze Höhe : 30.00 ... 100.00 cm xFrucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher  Zwiebel vorhanden
Zwiebel vorhanden  Milchsaft vorhanden
Milchsaft vorhanden Blütezeit
 Blütezeit Juli - 07
Blütezeit Juli - 07  Blütezeit August - 08
Blütezeit August - 08 Pflanze Jährigkeit
 Mehrjährig
MehrjährigHaare
Blätter
 Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter zweizeilig (nur bei Einkeimblättrigen)
Blätter zweizeilig (nur bei Einkeimblättrigen)  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Aderung in Längsblätter oder Teile (inkl. 3-teilige Blätter)
Aderung in Längsblätter oder Teile (inkl. 3-teilige Blätter)  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand eine Dolde, einfach und monopodial
Blütenstand eine Dolde, einfach und monopodial  Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)
Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 bisexuell
bisexuell  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig
zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig  Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)  Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend
Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 3
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 3  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6  Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten
Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 0 (inkl. 1 becherartiger Kelch ohne Lappen)
Kelchblätter 0 (inkl. 1 becherartiger Kelch ohne Lappen)  Blütenblätter 3
Blütenblätter 3  Blütenblätter 6
Blütenblätter 6  Blütenblätter alle frei voneinander
Blütenblätter alle frei voneinander  Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)
Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)  Blütenblätter schuppig
Blütenblätter schuppig  Corona vorhanden oder im Grunde Schuppig
Corona vorhanden oder im Grunde Schuppig  Staubbeutel 3, fruchtbar
Staubbeutel 3, fruchtbar  Staubbeutel 6, fruchtbar
Staubbeutel 6, fruchtbar  Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar
Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar  Anzahl Staubblätter = Anzahl Blütenblätter oder verschieden von Kelchblätter
Anzahl Staubblätter = Anzahl Blütenblätter oder verschieden von Kelchblätter  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubblätter in die Krone eingefügt
Staubblätter in die Krone eingefügt  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel
Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel  Staubfäden verwachsen - in getrennten Bündeln
Staubfäden verwachsen - in getrennten Bündeln  Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)
Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  Fruchknoten 3-kammerig
Fruchknoten 3-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  2 Samen pro Fruchtkammer
2 Samen pro Fruchtkammer  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Samenanlagen seitlich, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen seitlich, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)
Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)  Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)
Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Samen mit Flügeln
Samen mit Flügeln  Keim gerade
Keim gerade  Samen mit Nährgewebe
Samen mit Nährgewebe Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Australien und Ozeanien
Australien und Ozeanien  Europa
Europa  Nordamerika
Nordamerika  Südamerika
Südamerika  Previous
Previous