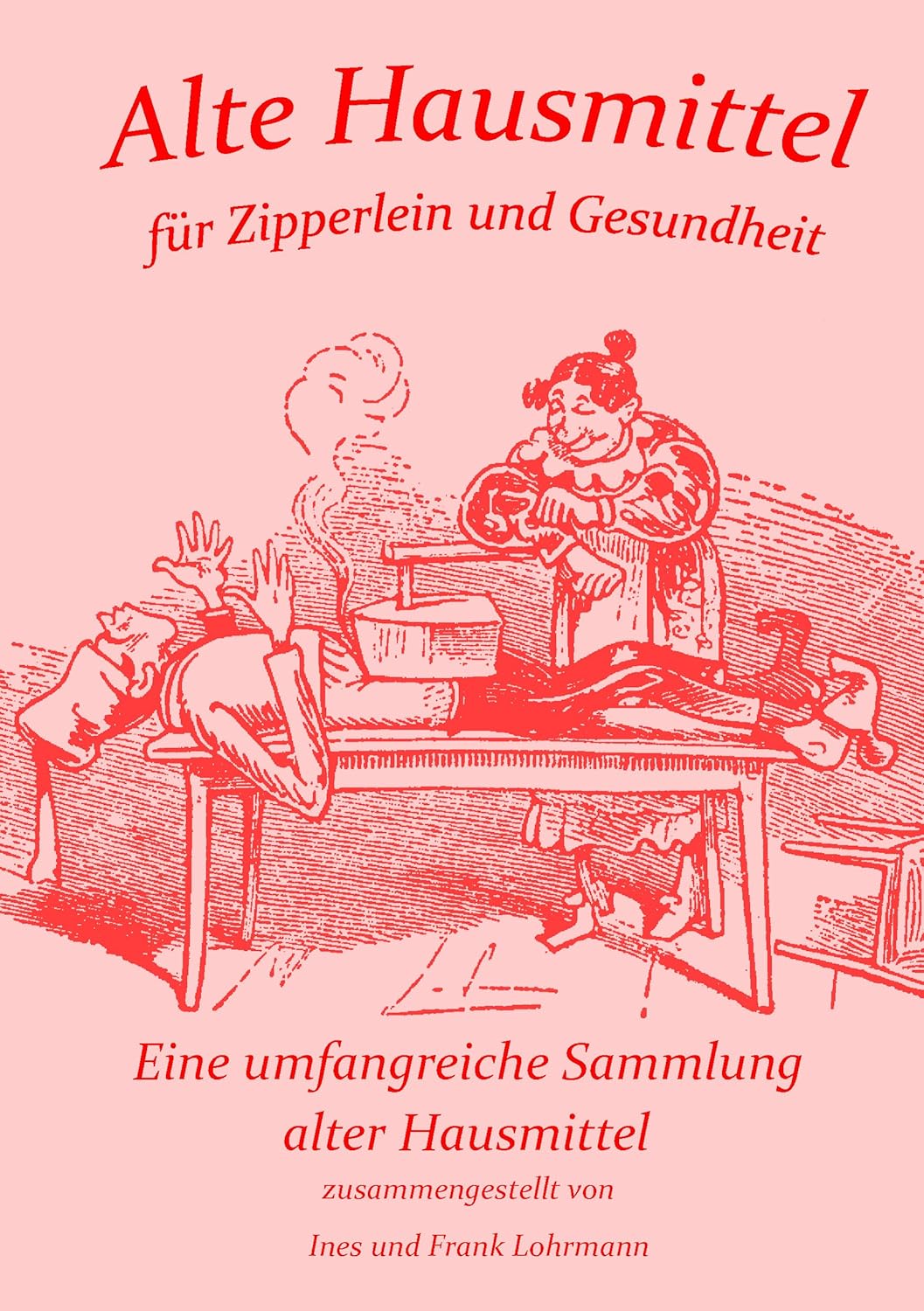Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Hänge-Birke - Betula pendula Roth
Englisch: Birch, Blue birch, Canoe birch, Common Birch, Eurasian Weeping Birch, European Birch, European Weeping Birch, European white birch, Fun birch, Happy birch, New birch, Old birch, Silver Birch, Sonjosuáhi, Tree birch, Weeping birch, White birch
Französisch: bois a balais, Bouleau, Bouleau verruqueux
China: 垂技棒 chuízhīhuà, 抚皮樺 yóupíhuà
Russisch:

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Braunmaserbirke
Gemeine Birke
Hänge-Birke
Hängebirke
Sand Birke
Sand-Birke
Sandbirke
Trauer-Birke
Trauerbirke
Warzen-Birke
Warzenbirke
Weiss-Birke
Weissbirke
Weiß-Birke
Weißbirke
Synonyme :
Betula alba subsp. arborescens Wallr.
Betula alba var. carelica Merklein
Betula alba var. microphylla Wallr.
Betula alba var. microphylla Wimm.
Betula alba var. pendula (Roth) Cariot & St.-Lag.
Betula alba var. pendula (Roth) W.T.Aiton
Betula alba var. urticifolia Spach
Betula ethmensis Raf.
Betula ethmensis Raf. ex Regel
Betula laciniata Wahlenb.
Betula lobulata Kanitz
Betula oxycoviensis Besser
Betula pendula f. dalecarlica (L.f.) C.K.Schneid.
Betula pendula f. pendula
Betula pendula f. purpurea (Andre) C.K.Schneid.
Betula verrucosa Enrhart
Betula verrucosa f. dalecarlica L.f.
Betula verrucosa f. elegans Dippel
Betula verrucosa var. bircalensis Mela
Blatt: Laubblätter aus breit-keilförmigem Grunde dreieckig-rhombisch, mit nicht abgerundeten Seitenecken, dünn, etwas klebrig, oben lebhaft, unten heller grün, scharf doppelt gesägt, 4-7 cm lang und 2,5 bis 4 cm breit.
Stengel bzw. Stamm: bis 30 m hoher Baum mit schneeweißer Rinde, die sich in horizontalen Streifen abschält und sich bald in eine schwarze, steinharte Borke verwandelt. Zweige zuletzt meistens hängend. Junge Zweige ziemlich dicht mit warzigen Harzdrüsen besetzt, außerdem kahl. Die alten Zweige kahl, oft drüsenlos.
Blüte: Männliche Kätzchen sitzend, länglich-walzenförmig, hängend, bis 10 cm lang. Weibliche Kätzchen gestielt, zylindrisch, ausgewachsen 2 bis 4 cm lang und 8 bis 10 mm dick, dichtblütig, zuerst gelbgrün, später hellbraun. Fruchtschuppen bräunlich, behaart oder kahl. Mittellappen klein, kurz, dreieckig, kürzer als die breiten, stets zurückgebogenen Seitenlappen. Fruchtflügel halboval, zwei- bis dreimal so breit als die Frucht. Blütezeit April, Mai.
Vorkommen: in Nord- und Mitteleuropa verbreitet und geht bis nach Nordasien. Im südlichen Europa kommt sie nur in den Gebirgen vor. In Laub- und Nadelwäldern, an trockenen Stellen ist sie häufig, an Waldrändern, trockenen Mooren, an buschigen Abhängen, auf Heidewiesen, auf torfigem oder trockenem Sandboden, an steilen Hängen, auf Dünen. Sie ist ein Baum, der an Klima und Boden sehr geringe Anforderungen stellt und gegen Frost und Dürre vollkommen unempfindlich ist. Sie wächst gern auf eisenhaltigem Boden.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Die Birke ist wahrscheinlich schon in der Urheimat der Indogermanen vorgekommen, da wir den Namen im Sanskrit und außer bei den germanischen auch bei den slawischen Völkern antreffen. Bei den alten Griechen und Römern scheint sie dagegen fast unbekannt gewesen zu sein. In Europa führt man den Birkenkult darauf zurück, daß die Birke und die Espe die ältesten postglazialen Bäume Nordeuropas waren. Sie lieferte den germanischen Schönheits- und Stärketrank. Im deutschen Volksglauben ist sie der Frühlingsbaum, an den sich viele Volkssitten, z. B .. das Maibaumstecken, knüpfen. Aber auch als hexenabwehrendes und als Erziehungsmittel wurde sie immer angewandt, so weihten die Druiden ihre Schüler mit einem Birkenzweig und Tau. Ein Schulmittel der Landbader gegen den Brand und fressenden Krebs war grünes Birkenlaub, das man klein machte und drei Wochen in Weißbier gären ließ. Birkenlaubwasser diente auch zu kühlenden Umschlägen. Das übertragen von Krankheiten auf Bäume, ein in der Sympathieheilmedizin gern gebrauchtes Mittel, wird auch bei der Birke geübt.
Genussmittel, Nahrungsmittel:
junge Rinde: gekocht als Gemüse, Gemüseauflauf
Saft: eingekocht als Zuckersirup, auch frisch, zur Weinherstellung
Blätter: getrocknet als Tabakersatz, als Tee, getrocknet u. gemahlen als Streckmehl, Würze, Kräuterkäse, Gemüsegerichte
Medizinisch:
Volksmedizin:
Bei den slawischen Völkern wird die Birke sehr häufig als Heilmittel verwendet. So werden in Russland die Blätter bei Rheumatismus, Schnittwunden und Hautausschlägen gebraucht. Innerlich wird der Birkenspiritus gegen Fieber, Brust- und Magenleiden verwendet.
In der Volksmedizin wird ein Rinden-Dekokt bei Wassersucht und Hautkrankheiten getrunken. Äußerlich werden Bäder bei übermäßigem Schweiß, Fußschweiß, Hautinfektionen, Hautausschlägen genutzt, als Umschlag werden die Rinden gegen Abszesse verwendet.
Aus der weißen, lederartigen Korkschicht wird der Birkenteer und durch Destillation das Birkenöl, Juchtenöl, Döggut gewonnen.
Man schneidet oder bohrt im März oder April bis Anfang Mai die Birken an und fängt den ausfließenden Saft in Gefäße auf. Diesen Saft lässt man entweder gären oder versetzt ihn auch unvergoren mit Zimt und Gewürznelken. Der Saft wird äußerlich zur Beseitigung der Sommersprossen und sonstiger Gesichtsflecke angewandt. Weiter soll er auch Mundausschläge, Pocken und rote Augen heilen. Der Birkensaft wird getrunken bei Hämorrhoiden und inneren Erkrankungen, Blasensteinen, Wassersucht und Würmern. Der Birkensaft liefert durch Gärung ein schaumweinähnliches Getränk, den sogenannten Birkenwein.
Der Birkenteer wird zur Behandlung von chronischen Hautkrankheiten wie Psoriasis und Ekzemen verwendet. Verarbeitet zu Salbe dient er der Behandlung von Hautparasiten und Hautinfektionen, Flechten und Dermatosen. Birkenteer kann zu unerwünschten Hautreizungen führen.
Die Blätter werden gegen Diabetes angewendet, sind aber in der Volksmedizin als Tee auch ein Mittel gegen bakterielle Infektionen der Harnwege, Blasenentzündung, Nierensteine und Nierengrieß, Rheuma, Gicht. Als Bad werden die Blätter bei Arthritis verwendet. Oft wurden im Frühjahr Entgiftungskuren aus Blättern und Birkensaft verwendet.
Die Rinde verschiedener Betulaarten sind in China schon seit dem 10. Jahrhundert als Huamu-pi u. a. gegen Ikterus, Mamakarzinom und Eiterungen bekannt.
Birkenkohle dient der Behandlung von Magenbeschwerden, Herz-Kreislauf-Schwäche, Entzündungen der Atemwege und Krampfadern.
Inhaltsstoffe der Rinde sind Gerbstoffe (Proanthocyanidin), Leucoanthocyanidin, Triterpene (Betulin, Lupeol, Betulinsäure), Pheonocarbonsäure, Betulosid, ätherisches Öl.
Aus der Rinde wird Birkenteer gewonnen.
Die Blätter enthalten Flavonoide (Hyperosid, Quercitrin), Proanthocyanidine, Triterpene (Dammaranderivate), Monoterpenglucosied, Phenolcarbonsäure, Kaffeesäure, Chlorogensäure, ätherisches Öl, Ascorbinsäure und Mineralien.
Der Birkenteer enthält aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe (Guajacol, Kresol, Brenzcatechin, Phenol), Behensäure, Pyrogalloldimethylether-Derivate.
Aktivität:
Antibakteriell; Antimelanomisch; Antiseptisch; Durchblutungssteigernd; Entwässernd; Entzündungshemmend; Fiebersenkend; Parasiten abtötend; Reinigend; Saluretikum; Schmerzlindernd; Wasserausscheidung fördernd; Zusammenziehend;
Indikation:
Arthrose; Bakterien; Bauchschmerzen oder Leibschmerzen; Blasensteine; Bronchitis; Dermatosen; Schmerzen; Durchfall; Ekzeme und Neurodermitis; Entzündungen; Fieber; Gallenblasenentzündung; Gicht; Grieß in Blase oder Niere; Haarausfall; Halsdrüsengeschwulst; Harnblasenentzündungen; Harnröhrenentzündung; Infektion; Krätze; Melanom; Mundfäule; Muskelschmerzen; Nervenschmerzen; Nierensteine; Parasiten; Psychosen; Rheumatismus; Schuppen; Schuppenflechte; Staphylococcus; Steine; Venenentzündungen; Verdauungsstörungen; Wassereinlagerungen; Wunden; Würmer;
Dosierung:
1–2 Esslöffel gehackte Blätter/Tasse Wasser, mehrmals/Tag;
2–3 g mehrmals/Tag;
12 g/Tag.
2-3 g pulverisierte Blätter
0.25-1g Trockenextrakt
Traditionell werden Birkenblattextrakte über 2-4 Wochen eingenommen.
In der Homöopathie: dil. D 1, dreimal täglich 10 Tropfen.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Nicht für den Gebrauch bei Ödemen bei Personen mit Herz-oder Nieren-Problemen. Achtung: Öl ist giftig und wird auch leicht durch die Haut absorbiert.
Speisewert:
Medizinisch
6 Bild(er) für diese Pflanze
Abmessungen:
Frucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher
Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher Blütezeit
 Blütezeit April - 04
Blütezeit April - 04  Blütezeit Mai - 05
Blütezeit Mai - 05Pflanze Jährigkeit
 Mehrjährig
MehrjährigHaare
 Haare schildförmig oder schuppig
Haare schildförmig oder schuppig Blätter
 Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.
Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.  Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)
Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)  Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind)
Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind) Blütenstand
 Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial
Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 unisexual
unisexual  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 1
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 1  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 3
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 3  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5  Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten
Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten  Kelchblätter 1
Kelchblätter 1  Kelchblätter 3
Kelchblätter 3  Kelchblätter 4
Kelchblätter 4  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)
Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)  Kelchblätter schuppig oder verzerrt
Kelchblätter schuppig oder verzerrt  Staubbeutel 2, fruchtbar
Staubbeutel 2, fruchtbar  Staubbeutel 4, fruchtbar
Staubbeutel 4, fruchtbar  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel nach Aussen gerichtet
Staubbeutel nach Aussen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubbeutel 1-kammerig zur Blüte
Staubbeutel 1-kammerig zur Blüte  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - in getrennten Bündeln
Staubfäden verwachsen - in getrennten Bündeln  Stiele fehlend, Narben direkt aufsitzend
Stiele fehlend, Narben direkt aufsitzend  Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)
Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)  Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  Fruchknoten 2-kammerig
Fruchknoten 2-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)
Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)  Frucht hat 1 Samen
Frucht hat 1 Samen  Frucht mit Flügeln
Frucht mit Flügeln  Keim gerade
Keim gerade  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe Verbreitung
 Asien
Asien  Europa
Europa  Previous
Previous