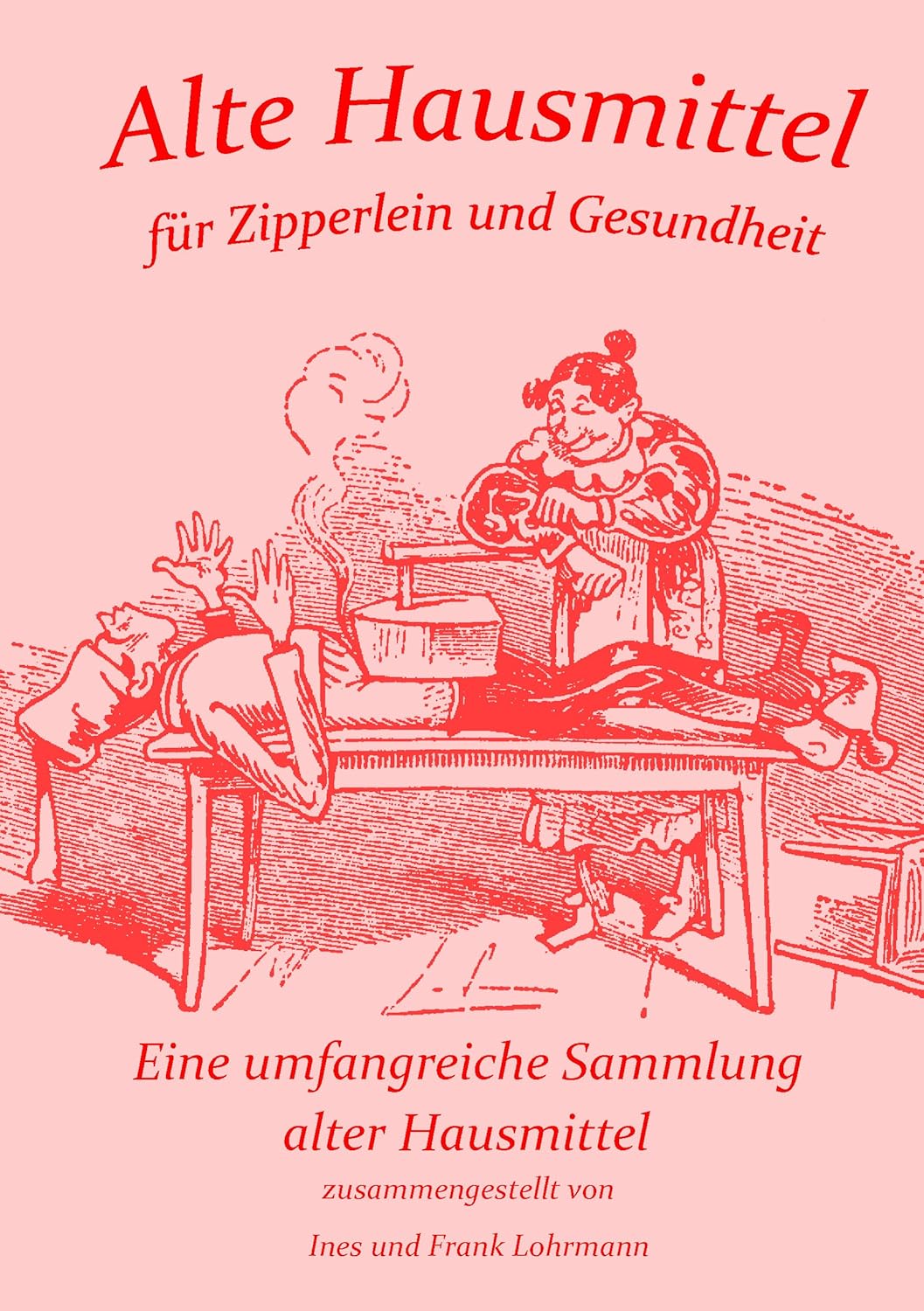Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Aprikose - Prunus armeniaca L.
Englisch: Abrecocke, Albaricoque, Ansu Apricot, Apricocke tree, Apricot, Apricot tree, Common apricot, Kajsija, Siberian apricot, Tibetan Apricot, Wild Apricot, زردآلو زینتی
Portugiesisch: abricó, damasco
Persisch: Mischmisch

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Amarelle
Aprikose
Aprikosen
Aprikosenbaum
Barille
Malete
Marille
Marillen
Marillenbaum
Morelle
Synonyme :
Amydalus armeniaca (L.) Dumort.
Amygdalus armeniaca (L.) Dum.Cours.
Amygdalus armeniaca (L.) Dumort.
Armeniaca anomala (Koehne) Kovalev & Kostina
Armeniaca armeniaca (L.) Huth
Armeniaca batavica Poit. & Turpin
Armeniaca berricoccia Delarbre
Armeniaca communis Besser
Armeniaca communis Poit. & Turpin
Armeniaca cordifolia Rouy & Camus
Armeniaca duracina Dierb.
Armeniaca epirotica G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Armeniaca macrocarpa Poit. & Turpin
Armeniaca malus Garsault
Armeniaca mongametia Poit. & Turpin
Armeniaca praecox Poit. & Turpin
Armeniaca tardiflora Poit. & Turpin
Armeniaca vulgaris Lam.
Armeniaca vulgaris var. persicoides Pers.
Armeniaca vulgaris var. praecox Pers.
Armeniaca vulgaris var. rushanica Korsh.
Armeniaca vulgaris var. rushanica Korsh. ex E.A.Sokolova
Prunus amarella Rchb.
Prunus armeniaca subsp. communis Schübl. & G.Martens
Prunus armeniaca subsp. dulcis Schübl. & G.Martens
Prunus armeniaca subsp. minor Schübl. & G.Martens
Prunus armeniaca subsp. persicoides (Pers.) Schübl. & G.Martens
Prunus armeniaca subsp. vulgaris (Lam.) Dippel
Prunus armeniaca var. vulgaris Zabel
Prunus mira Poit. & Turpin
Prunus nepalensis hort.
Prunus nepalensis hort. ex K.Koch
Prunus tiliifolia Salisb.
Prunus xanthocarpos hort.
Prunus xanthocarpos hort. ex K.Koch
Blatt: 3 bis 4 Meter hoher Baum mit breit-eiförmigen, doppeltgesägten, zugespitzten, kahlen, in der Knospe gerollten Blättern.
Blüte: Blüten vor den Blättern erscheinend, zu 1 bis 2 beisammenstehend, mit kurzen in den Knospenschuppen verborgenen Stielchen. Blumenkrone weiss, mit rötlichem Anfluge. Blütezeit März, April. Homogam, meist von Bienen bestäubt.
Frucht bzw. Samen: Frucht rundlich, sammethaarig, gelb, an der Sonnenseite rot, fleischig-saftig. Steinkern eiförmig, mit breitem, scharfem Kiele.
Vorkommen: Aus dem Oriente stammend, bei uns angebaut.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Kulturpflanze, Winterhärte 5-6.
Genussmittel, Nahrungsmittel:
Die Früchte sind essbar. Sie werden roh gegessen, konserviert, getrocknet usw. Aus den Kernen kann Pfirsichkern-Öl gewonnen werden. Der Kern dient auch als Mandelersatz.
Auf Grund der Inhaltsstoffe (Blausäure) im Kern, sollte auf eine Verwendung verzichtet werden.
Medizinisch:
Die Kerne enthalten Amygdalin, Prunasin, Fettsäuren, Mandelonitril (Das Enzym Amygdalase kann Amygdalin hydrolysieren, so dass
Blausäure entsteht.)
Sie wirken beruhigend und können das Atemzentrum reflexartig stimulieren.
Aktivität:
Antitumor; Aphrodisiakum; Beruhigend; Bruststärkend; Cyanogen; Erweichend; Gegen Schilddrüsenüberfunktion; Gegenmittel bei Vergiftungen; Giftig; Hustenstillend; Krampflindernd; Kräftigend, Stärkend; Reizlindernd; Schleimlösend, Hustenlöser; Wundheilend, Anti-Krebs; Wurmmittel;
Indikation:
Anämie; Asthma; Blutandrang; Blutungen; Bronchitis; Durst; Ekzeme Krätze und Juckreiz; Entbindung; Entzündungen; Erkältungen; Fieber; Geschwülste; Halsschmerzen; Herzprobleme; Husten; Katarrh; Kehlkopfentzündung; Krebs; Krämpfe; Magengeschwüre und Darmgeschwüre; Nervosität und Unruhe; Rheumatismus; Schlafstörungen; Schlangenbisse; Schmerzen; Trichomoniasis; Tumor; Unfruchtbarkeit; Vaginose; Verstopfung; Vulvitis; Würmer; Zahnschmerzen;
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Die Kerne enthalten Blausäure. 20 bis 60 Kerne können Erwachsene töten; 7-10 Kerne können für Kinder tödlich sein.
Können Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen. Können Kontakt-Dermatosen verursachen. Können Zyanid-Vergiftungen verursachen. Sollten in der Schwangerschaft und Stillzeit gemieden werden. Mehr als 20 Todesfälle wurden durch Einnahme der Aprikosen-Kerne verursacht. Symptome einer akuten Vergiftung sind Krämpfe, Schwindel, Benommenheit, Atemnot, Kopfschmerzen, Hypotonie, Übelkeit, Lähmungen, Koma und Tod. Der Tod kann von 1 bis 15 Minuten nach der Einnahme auftreten. Gegenmittel für Zyanid-Vergiftungen sind Aminophenol, Dikobalt-edetat, Hydroxocobalamin, Nitrit und Thiosulfat. Aprikosenkerne können Ataxie, Blindheit, Kretinismus, Kropf, Hypertonie, erhöhten Blutdruck, Läsionen des Sehnervs, geistige Retardierung und Schilddrüsenkrebs verursachen. Kerne mancher Sorten können bis zu 8 Prozent Zyanide enthalten. Die Kerne enthalten auch Amygdalin, bekannt als Laetril oder Vitamin B17. Diese sind selbst nicht giftig, jedoch deren Abbauprodukte Cyanid und Benzaldehyd. Auf Grund des Amygdalingehaltes werden sie in einigen alternativen Krebstherapien verwendet.
Dosierung:
3-5 g Samenkerne
Speisewert:
Medizinisch
8 Bild(er) für diese Pflanze
Abmessungen:
Pflanze Höhe : 100.00 ... 500.00 cm xFrucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher
Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher  Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher  Kletterpflanzen, Lianen
Kletterpflanzen, Lianen  Stacheln an Stamm oder Blatt
Stacheln an Stamm oder Blatt Blütezeit
 Blütezeit März - 03
Blütezeit März - 03 Blütezeit April - 04
Blütezeit April - 04 Pflanze Jährigkeit
 Mehrjährig
MehrjährigHaare
 Haare drüsig, warzig
Haare drüsig, warzig  Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig
Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig  Haare Sternzellig (nicht 2-armig, verzweigt oder federig)
Haare Sternzellig (nicht 2-armig, verzweigt oder federig)  Haare federig, aber nicht drüsig
Haare federig, aber nicht drüsig  Haare schildförmig oder schuppig
Haare schildförmig oder schuppig Blätter
 Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)
Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)  Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter schildförmig
Blätter schildförmig  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Blätter mehrteilig, verzweigt, kompliziert
Blätter mehrteilig, verzweigt, kompliziert  Blätter gefiedert (4 oder mehr Blätter)
Blätter gefiedert (4 oder mehr Blätter)  Blätter 3-teilig
Blätter 3-teilig  Blätter handförmig (4 oder mehr Teile)
Blätter handförmig (4 oder mehr Teile)  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Aderung handförmig in Blätter oder Blatteile
Aderung handförmig in Blätter oder Blatteile  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt
Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt  Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.
Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.  Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)
Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen  Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind)
Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind) Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand eine Rispe, einfach und monopodial
Blütenstand eine Rispe, einfach und monopodial  Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial
Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial  Blutenstand eine Doldentraube, einfach und monopodial
Blutenstand eine Doldentraube, einfach und monopodial  Blütenstand eine Dolde, einfach und monopodial
Blütenstand eine Dolde, einfach und monopodial  Blütenstand ein Büschel, einfach und monopodial
Blütenstand ein Büschel, einfach und monopodial  Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial
Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 bisexuell
bisexuell  unisexual
unisexual  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig
zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig  Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend
Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend  Blütenboden vergrössert, ganz oder teilweise frei vom Fruchtknoten
Blütenboden vergrössert, ganz oder teilweise frei vom Fruchtknoten  Blütenboden vergrössert, konisch oder kalbkugelförmig (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden vergrössert, konisch oder kalbkugelförmig (oberständiger Fruchtknoten)  Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)
Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 3
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 3  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6  Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6  Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten
Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 3
Kelchblätter 3  Kelchblätter 4
Kelchblätter 4  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter mehr als 5
Kelchblätter mehr als 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter schuppig oder verzerrt
Kelchblätter schuppig oder verzerrt  Blütenblätter 0 (inkl. Einem becherartigen Blütenkrone ohne Blätter)
Blütenblätter 0 (inkl. Einem becherartigen Blütenkrone ohne Blätter)  Blütenblätter 3
Blütenblätter 3  Blütenblätter 4
Blütenblätter 4  Blütenblätter 5
Blütenblätter 5  Blütenblätter 6
Blütenblätter 6  Blütenblätter 7
Blütenblätter 7  Blütenblätter 8
Blütenblätter 8  Blütenblätter 9
Blütenblätter 9  Blütenblätter 10
Blütenblätter 10  Blütenblätter mehr als 10
Blütenblätter mehr als 10  Blütenblätter alle frei voneinander
Blütenblätter alle frei voneinander  Blütenblätter schuppig
Blütenblätter schuppig  Blütenblätter verzerrten
Blütenblätter verzerrten  Staubbeutel 1, fruchtbar
Staubbeutel 1, fruchtbar  Staubbeutel 2, fruchtbar
Staubbeutel 2, fruchtbar  Staubbeutel 4, fruchtbar
Staubbeutel 4, fruchtbar  Staubbeutel 5, fruchtbar
Staubbeutel 5, fruchtbar  Staubbeutel 8, fruchtbar
Staubbeutel 8, fruchtbar  Staubbeutel 10, fruchtbar
Staubbeutel 10, fruchtbar  Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar
Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel nach Aussen gerichtet
Staubbeutel nach Aussen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubbeutel durch die Spitze öffnend
Staubbeutel durch die Spitze öffnend  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel
Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel  Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)
Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)  Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)
Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Stempel gynobase entspringend
Stempel gynobase entspringend  Fruchtblatt 1
Fruchtblatt 1  Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  Fruchknoten 2-kammerig
Fruchknoten 2-kammerig  Fruchknoten 3-kammerig
Fruchknoten 3-kammerig  Fruchknoten 4-kammerig
Fruchknoten 4-kammerig  Fruchknoten 5-kammerig
Fruchknoten 5-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  2 Samen pro Fruchtkammer
2 Samen pro Fruchtkammer  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Fruchtblätter frei von einander oder 1 Fruchtblatt
Fruchtblätter frei von einander oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt  Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)
Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)  Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)
Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)  Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)
Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)  Frucht hat 1 Samen
Frucht hat 1 Samen  Frucht hat 2 Samen
Frucht hat 2 Samen  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Frucht mit Flügeln
Frucht mit Flügeln  Frucht mit Haaren zur Windverbreitung
Frucht mit Haaren zur Windverbreitung  Frucht mit rückgebogenen Stacheln, hakenförmige oder widerhakenförmige Haare
Frucht mit rückgebogenen Stacheln, hakenförmige oder widerhakenförmige Haare  Frucht mit Stacheln und Haken
Frucht mit Stacheln und Haken  Samen mit Flügeln
Samen mit Flügeln  Keim gerade
Keim gerade  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe  Samen mit Nährgewebe
Samen mit Nährgewebe Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Australien und Ozeanien
Australien und Ozeanien  Europa
Europa  Nordamerika
Nordamerika  Südamerika
Südamerika  Previous
Previous