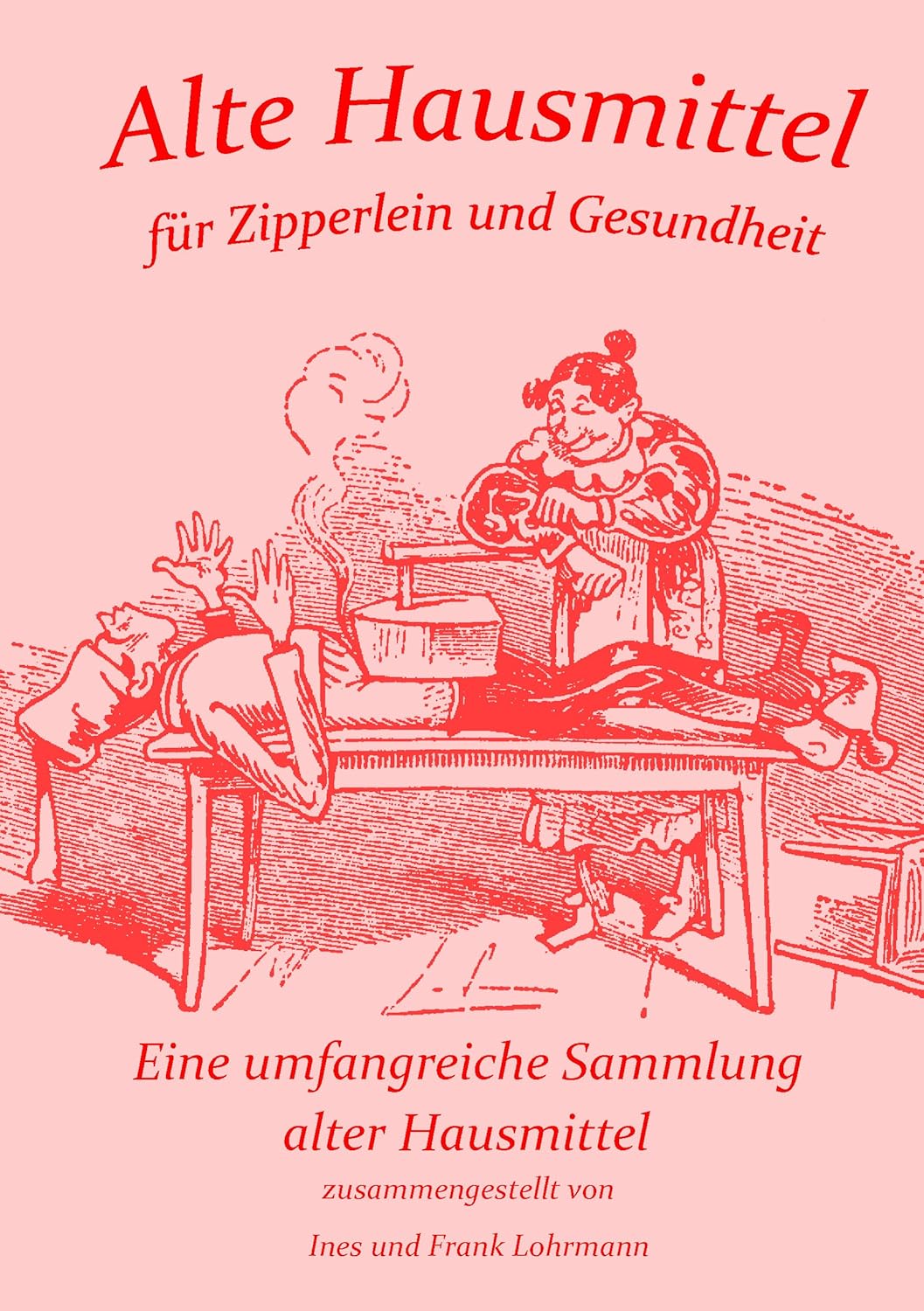Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Goldlack - Erysimum cheiri (L.) Crantz
Englisch: Common wallflower, Double yellow wallflower, Double yellow wall flowers, gilli flower, Gilly flower, Gilly flowers, Gillyflowers, ten week stock, Wall-flower, Wallflower, Wall flowers
Französisch: bäton d'or, giroflee de muraille, Giroflee jaune, jaunet, muret, murier, ravenelle jaune, violette de Saint George

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Golden Laken
Goldlack
Goldlack-Schöterich
Güllak
Pfingstfeigel
Stockviole
Synonyme :
Cheiranthus cheiri L.
Cheiranthus cheiri var. canescens N.H.F.Desp.
Cheiranthus cheiri var. ferrugineus DC.
Cheiranthus cheiri var. flavescens DC.
Cheiranthus cheiri var. fruticulosus DC.
Cheiranthus cheiri var. grandiflorus DC.
Cheiranthus cheiri var. maximus DC.
Cheiranthus cheiri var. multiplex N.H.F.Desp.
Cheiranthus cheiri var. patulus DC.
Cheiranthus cheiri var. serratus DC.
Cheiranthus cheiri var. thyrsoideus DC.
Cheiranthus helveticus Jacq.
Cheiranthus muralis (Lam.) Salisb.
Cheiranthus ×cheiri f. glaucescens Pamp.
Cheiranthus ×fruticulosus (Spreng.) L'Hér.
Cheiranthus ×fruticulosus (Spreng.) L'Hér. ex DC.
Cheiranthus ×intermedius Schleich.
Cheiranthus ×luteus Dulac
Cheiranthus ×silenifolius Willd.
Cheiri murale (Salisb.) Samp.
Cheiri ×montanum Clairv.
Cheiri ×vulgare Clairv.
Cheirinia helvetica (Jacq.) Link
Cheirinia ×suffruticosa Link
Crucifera ×cheiri (L.) E.H.L.Krause
Erysimum cheiriflorum Boiss.
Erysimum elatum Pomel
Erysimum lanceolatum subsp. helveticum (Jacq.) Arcang.
Erysimum ochroleucum subsp. helveticum (Jacq.) Nyman
Erysimum pseudocheiri Boiss.
Erysimum sessiliflorum W.T. Aiton
Erysimum suffruticosum Spreng.
Erysimum ×cheiri subsp. inexpectans Véla, Ouarmim & Dubset
Erysimum ×murale Lam.
Stengel bzw. Stamm: zweijähriger oder auch ausdauernder Halbstrauch von 20—60 cm Höhe. Die Wurzel ist spindelförmig, ästig und grau. Die verholzenden ästigen Sprosse sind aufrecht. Die Zweige tragen ziemlich reichlich Blätter. Sie erscheinen durch die Blattnarben knotig und endigen entweder in einem Blütenstand oder in einer sterilen Blattrosette. Der kantige Stengel ist ziemlich reichlich mit angedrückten Haaren besetzt. Die nachstäubenden Blüten werden durch langrüsselige Insekten bestäubt. Selbstbestäubung ist möglich. Im ersten Jahre entwickelt die Pflanze nur eine grundständige Blattrosette, erst im zweiten Jahre erscheint der Blütenstengel. Die fruchttragenden Stengel sterben im Winter gewöhnlich bis auf die verholzten Teile ab. Die Laubblätter sind sehr wenig frostempfindlich und welken oft erst mehrere Wochen nach dem Auftauen.
Blüte: Blätter länglich-lanzettlich, spitz, fast ganzrandig, je nach der Stellung kürzer oder länger gestielt. Die wohlriechenden Blüten bilden eine Traube. Die goldgelben Kronenblätter mit rundlich-verkehrteiförmiger Platte sind plötzlich in den Nagel zusammengezogen. Schoten aufrecht stehend, vom Rücken her zusammengedrückt. Narbe breit, zweilappig. Blütezeit Mai bis Juni, in Südeuropa auch im Winter blühend.
Vorkommen: Heimat der Pflanze ist Europa, Nordafrika und Westasien. In Deutschland wohl nur verwildert. Sie liebt kalkreichen Boden.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Als Zierpflanze geschätzt und u. a. als Schmuck für die Altäre und zur Umkränzung von Weinfässern bei festlichen Gelegenheiten benutzt.
Der Goldlack war schon im römischen und griechischen Altertum eine beliebte Heilpflanze, die in den Schriften von Hippokrates und Dioskurides Erwähnung fand. Daneben wurde er auch als Zierpflanze geschätzt und u. a. als Schmuck für die Altäre und zur Umkränzung von Weinfässern bei festlichen Gelegenheiten benützt. Heute ist er in verschiedenen Kulturformen in fast jedem Bauerngarten zu treffen. Wird als Emmenagogum und gegen Herzbeschwerden verordnet. Auch als Antispasmodikum, Anodynum und Purgans kann es versucht werden.
Medizinisch:
Der Goldlack war schon im römischen und griechischen Altertum eine beliebte Heilpflanze, die in den Schriften von Hippokrates und Dioskurides Erwähnung fand. Heute ist er in verschiedenen Kulturformen in fast jedem Bauerngarten anzutreffen. Sie dienten überwiegende als Diuretikum und Emmenagogum.
Wird als Emmenagogum und gegen Herzbeschwerden
verordnet. Auch als Antispasmodikum, Anodynum und Purgans wird er verwendet. Blüten und Stängel wirken antirheumatisch, kardiotonisch, nervenstärkend, abführend, emmenagogue und auflösend, sie dienen der Behandlung von Impotenz und Lähmungen. Die Samen wirken aphrodisierend, schleimlösend, magenstärkend, tonisch und harntreibend, sie werden bei Bronchitis, Fieber und Augenverletzungen genutzt.
Aktivität:
Abführend; Anregend und Wachmacher; Antibakteriell; Antiseptisch; Antitumor; Darmaktivierend; Digitalisch; Erweichend; Giftig; Herzstärkend; Kardiotoxisch; Krampflindernd; Kräftigend, Stärkend; Magenstärkend; Menstruationsfördernd; Muskelstärkend; Reinigend; Schleimlösend, Hustenlöser; Schmerzlindernd;
Indikation:
Arthrose; Asthma; Bakterien; Bronchitis; Krebs; Gelenkkrebs; Sehnenkrebse; Gebärmutterkrebs; Herzkrankheiten; Verstopfung; Krämpfe; Menstruationsbeschwerden; Gicht; Hepatose; Gewebeverhärtung; Entzündungen; Schmerzen; Sklerose; Zahnschmerzen; Tumor; Gebärmutterentzündung.
Dosierung:
2–3 g Blüten/100 ml Wasser als Tee, 3–4 Tassen pro Tag.
In der Homöopathie: dil. D 1, dreimal täglich 10 Tropfen.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Digitalis-Vergiftungen in schweren Überdosierungen sind möglich.
Da die Blüten an wirksamen Stoffen sehr arm sind, dürften die Arzneien am besten aus der ganzen frischen Pflanze vor der Blüte bereitet werden.
Speisewert:
Medizinisch
2 Bild(er) für diese Pflanze
Erysimum cheiri © José María Escolano @ flickr.com |
Erysimum cheiri © Bas Kers @ Delft (NL), Netherlands |
Abmessungen:
Frucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
Blütezeit
Pflanze Jährigkeit
Haare
Blätter
Blütenstand
Blüten
Früchte
Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Europa
Europa  Previous
Previous