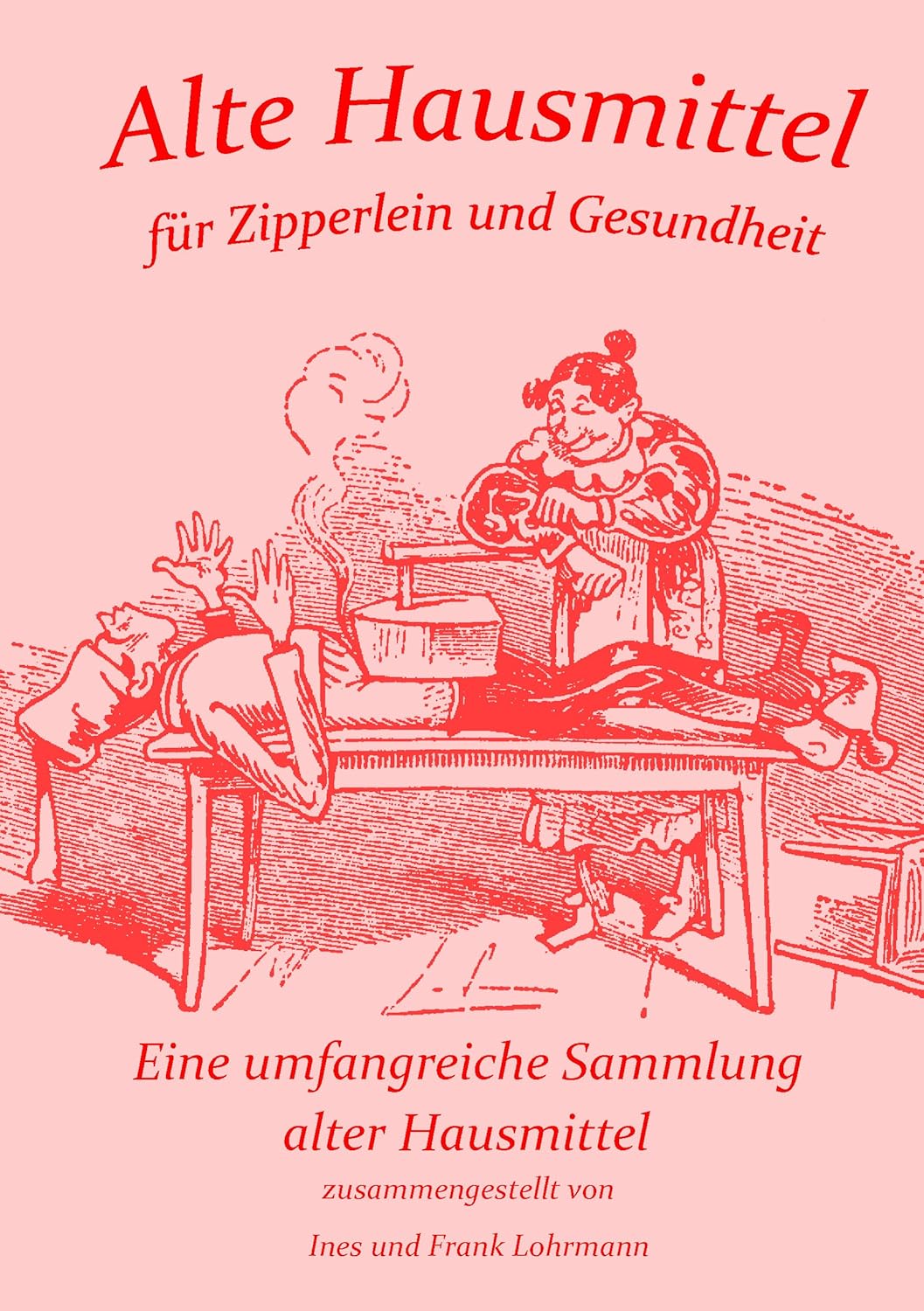Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Home > Tracheophyta > Magnoliopsida > Malpighiales > Hypericaceae > Hypericum > Echtes Johanniskraut
Echtes Johanniskraut - Hypericum perforatum L.
Englisch: Amber, Balm of-warrior’s-wound, Balm of warrior’s wound, Cammock, Common Saint-John's-wort, common St.-John’s-wort, Common St. John's-wort, Common St. John's Wort, common St. Johnswort, Common St. John’s wort, Common St Johnswort, Common St John’s-wort, Devil’s-scourge, Devil’s scourge, European St. John’s-wort, goatweed, God’s wonder plant, hardhay, Herb-John, Herbe John, Herb John, Hy pericum, Hysop, Hysope, Hyssop, Johns-wort, Johnswort, John’s-wort, John’s wort, Kantarion, Klamath weed, Klamathweed, Millepertuis, Mille Pertuis, Millepertuis Commun, Penny-John, Penny John, perforated St. Johns-wort, Perforate Saint-John's-wort, Perforate St. John's-wort, Perforate St John's-wort, Racecourseweed, Rosin-rose, Rosin rose, Saint Johannis wort, Saint John's Wort, Saynt Jo hannis wort, Saynt Johns wort, St. John, St. John's-wort, St. John's wort, St. Johnswort, St. John’s-bush, St. John’s-wort, St. John’s bush, St. John’s wort, St John's wort, St Johnswort, Sunătoare, Tindilinâ, Tipton's weed, Tiptonweed, Touch-and-heal, Tutsan, Witches’-herb, Witches’ herb, Witche’s herb
Portugiesisch: erva-de-são-joão, hiperição, hipérico, milfurada
Spanisch: corazoncillo, cori, hierba de San Juan, hipericón, hipérico, Hypericon
Französisch: Casse Diable, chasse-diable, Chasse diable, herbe aux piqüres, herbe de Saint Jean, Herbe St. Jean, herbe ä mille trous, Mille-pertuis, Toute saine
Russisch: зверобой продырявленный, зверобой пронзённолистный
China: 貫葉蓮翹 guànyfe liánqiko

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Blutkraut
Durchlöchertes Johanniskraut
Durchlölchertes Johanniskraut
Durchstochenblätteriges Hartheu
Echt-Johanniskraut
Echtes Johanneskraut
Echtes Johanniskraut
Echtes Tüpfel-Hartheu
Echtes Tüpfel-Johanniskraut
Elfenblut
Gemeiner Isop
Gemeiner Ysop
Gemeines Hartheu
Gemeines Johanniskraut
Gewöhnliches Johanniskraut
Herrgottsblut
Hexenkraut
Jagdenteufel
Jageteufel
Jarsin
Johannesblut
Johanneskraut
Johanneskraut, Tüpfel-Hartheu
Johannisblut
Johanniskraut
Johanniskrautöl
Konradskraut
Mannskraft
St. Johanniskraut
Teufelsflucht
Tüpfel Johanniskraut
Tüpfel-Hartheu
Tüpfel-Johanniskraut
Tüpfelhartheu
Tüpfeljohanniskraut
Walpurgiskraut
Wundskraut
Synonyme :
Hypericum assurgens Peterm.
Hypericum assurgens Peterm. ex Rouy
Hypericum perforatum f. brevispathum A.Fröhl.
Hypericum perforatum f. lucidum A.Fröhl.
Hypericum perforatum f. microphyllum (DC.) Fiori
Hypericum vulgare Lam.
Hypericum vulgare Neck.
Blatt: Die gegenständigen Blätter sind elliptisch-eiförmig, länglich oder lineal, ungestielt, ganzrandig, kahl, durchscheinend punktiert und meist nur am Rande mit schwarzen Drüsen besetzt.
Stengel bzw. Stamm: ausdauernde Pflanze mit langlebiger, spindelförmiger, reichästiger Wurzel und ästigem Erdstock erreicht eine Höhe von 20—100 cm. Der Stengel ist aufrecht, im oberen Teil ästig und stielrund mit zwei Längskanten, kahl, bereift und gegen die Spitze zu mit Drüsen besetzt.
Blüte: Die gelben Blüten stehen an der Spitze der oberen Äste und bilden einen ausgebreiteten ebensträußigen, trugdoldigen Blütenstand. Die Kelchblätter sind eilanzettlich bis lanzettlich, fein zugespitzt und mehr oder weniger reichlich mit hellen und schwarzen, punkt- bis strichförmigen Drüsen besetzt. Die schief-elliptischen Kronenblätter sind goldgelb mit schwarzen Punkten und helleren oder dunkleren Strichen auf der Fläche, Die zahlreichen (50—100) Staubgefäße stehen in drei Bündeln. Fruchtknoten breit- bis schmal-eiförmig mit drei langen Griffeln. Blütezeit Ende Juni bis Herbst.
Vorkommen: Europa, Westasien, Nordafrika heimisch, in Ostasien, Amerika und Australien eingebürgert. Verbreitet und häufig im ganzen Gebiete auf meist ziemlich trockenen Kalk- oder Urgesteinsböden, auf trockenen, sonnigen Grasplätzen, auf Hügeln und Bergen, auf Mauern und an Wegen.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Aus den oberirdischem Kraut lässt sich Farbstoff gewinnen.
Genussmittel, Nahrungsmittel:
Blätter: Tee, Likör, Würze/Gewürz zu Fisch, Kräuteröl, Sirup
Blüten: essbare Dkoration
Beim Zerquetschen der Blüten tritt ein blutroter Saft aus, der die Finger blauviolett färbt, was zu vielen Sagen und mystischen Anwendungen Anlaß gegeben hat. Blüten und Kraut – Hyperici herba - sind offizinell. Sie werden innerlich zur Nervenstärkung und zur Dämpfung von Depressionen verwendet. Ölige Auszüge werden auch äußerlich zur Wundheilung, bei Verbrennungen und Muskelschmerzen verwendet.
Medizinisch:
Schon seit dem frühen Altertum ist das Johanniskraut als Heilpflanze bekannt. Auch im Mittelalter wurde es in den Kräuterbüchern beschrieben. Es war auch Mittel für kultische Handlungen um den Verleitungen des Teufels zu widerstehen.
Blüten und Kraut – Hyperici herba - sind offizinell. In der Volksmedizin wird es innerlich zur Nervenstärkung und zur Dämpfung von Depressionen verwendet. Ölige Auszüge werden auch äußerlich zur Wundheilung, bei Verbrennungen und Muskelschmerzen verwendet.
Die Blüten werden im Juli/August gesammelt. Sie finden z.B. als Oleum hyperici (Rotöl, Johanniskrautöl) als öliges Mazerat der gequetschten Blüten zur Wundheilung und zur Nachbehandlung von Verletzungen, Verbrennungen und Myalgien, bei Rheuma und Hexenschuss äußerlich Verwendung.
Das Kraut wird kurz vor bzw. während der Blüte gesammelt, getrocknet und gemahlen. Es wird in der Volksmedizin bei Nervosität und leichten Depressionen als Tee oder Tinktur verwendet und hat auch Eingang in die moderne Pharmazie gefunden.
In der Homöopathie dient das Kraut der Behandlung von Herzerkrankungen, Nervenerkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, des Kreislaufs und Verletzungen.
Die ganze Pflanze enthält Quercetin, Quercitrin, Isoquercitrin,
Sarolactone, Hypericin, Pseudohypericin, Sigtoercin, Protohypericin, Kaempferol.
Das Kraut enthält Gerbstoffe (Catechinderivate).
Die Blüten enthalten Flavonoide (Hyperosid), Biflavone (Amentoflavon), Xanthone, Naphthodianthrone (Hypericin), Phloroglucinderivate (Hyperforin), ätherisches Öl.
Hypericin und Pseudohypericin legen nahe, in der photodynamischen Tumortherapie gegen menschliche Krebszelllinien von Brustkrebs, Dickdarmkrebs, Lungenkrebs, Melanom verwendet zu werden. Albinin senkt jedoch die photozytotoxische Wirkung von Pseudohypericin gegen die A431 Krebszelllinie, was die Verwendbarkeit der Therapie einschränkt.
Hypericin und Pseudohypericin wirken stark antiretroviral und verhindern effektiv eine Vielzahl von Infektionen mit Retrovieren in vivo und in vitro, wobei wahrscheinlich Pseudohypericin direkt den Virus inaktiviert oder für eine Ausscheidung des Virus aus der Zelle sorgt, wobei keine direkte Aktivität gegen virale Proteine an der Zellmembran und auch keine Wirkung auf die Polymerase feststellbar ist. Bei Untersuchungen an Menschen, die das Medikament gegen Diabetes genommen haben, wurden offensichtlich heilsame Wirkungen ohne schädliche Nebenwirkungen attestiert, weshalb die Wirkstoffe ein großes Potential gegen entsprechende Infektionen haben, wie z.B. gegen AIDS.
Hauptsächliche Anwendung:
Innerlich: Depressive Verstimmungen, Psychovegetative Störungen, Angst und/oder nervöse Unruhe.
äußerlich: Ölige Hypericumzubereitungen bei Traumata und Hautläsionen.
Aktivität:
Angstlösend; Anregend und Wachmacher; Anti-Krebs; Antibakteriell; Antidepressant; Antiherpetisch; Antiretroviral; Antiseptisch; Antiviral; Aperitif; Bandwürmer; Beruhigend; Beruhigungsmittel; Blutdrucksenkend; Blutgefäßverengend; Blutung stillend; Brechreizhemmend; COMT Inhibitor; Dopaminerge; Entwässernd; Entzündungshemmend; GABA-Reuptake Inhibitor; Galle treibend; Gebärmutterkräftigend, Stärkend; Gegenmittel bei Vergiftungen; Geschwürvorbeugend; Immunstimulans; Krampflindernd; Kräftigend, Stärkend; MAO-Hemmer; Melatoninergisch; Menstruationsfördernd; Nervenschmerz verringernd; Nervenstärkend; Psychotropisch; Resolvent; SSRI; Schleimlösend, Hustenlöser; Schmerzlindernd; Serotoninergen; Verdauungsfördernd; Wundheilend; Wurmmittel; Zusammenziehend;
Indikation:
Alkoholismus; Angst; Anregend und Wachmacher; Anurie; Appetitlosigkeit; Asthma; Bakterien; Ballenzeh; Bandwürmer; Beklemmung; Bisse; Blasensteine; Blut im Urin; Blutandrang; Bluthochdruck; Bluthusten; Blutsturz; Blutungen; Blähungen; Bronchitis; Brustknoten; Brustkrebs; Calcification; Concussion; Coxalgia; Cyanose; Cytomegalovirus; Darmentzündungen; Depression; Dermatosen; Schmerzen; Durchfall; Eierstockkrebs; Einnässen; Ekzeme und Neurodermitis; Endometriose; Entbindung; Entzündungen; Epilepsie; Erkältungen; Fibrososis; Fieber; Gallenblasenentzündung; Gastroduodenitis; Gebärmutterentzündung; Gebärmutterkrebs; Gehirnentzündung; Gelbsucht; Geschwülste; Gewebeverhärtung; Gicht; Grippe; Gürtelrose; HIV; Haarausfall; Halsschmerzen; Harnblasenentzündungen; Harnstrenge; Hämorrhagie; Hepatose; Herpes; Herzkrankheiten; Hexenschuss; Husten; Hydrophobie; Hysterie; Hämorriden; Hörprobleme; Immunodepression; Impotenz; Infektion; Ischias; Katarrh; Keuchhusten; Kopfschmerzen; Krebs; Krämpfe; Lungentuberkulose; Lymphdrüsenerkrankungen; Lymphdrüsenkrebs; Lymphosis; Lähmungen; Magenerkrankungen; Magengeschwüre und Darmgeschwüre; Magenkrebs; Magersucht; Mandelentzündung; Melancholie; Menopause; Menstruationsbeschwerden; Migräne; Morbus Crohn; Mundfäule; Muskelschmerzen; Nasenbluten; Neck; Nervenprobleme; Nervenschmerzen; Nervenschwäche; Nervosität und Unruhe; Neurofibromatosis; Neurosen; Noktambulismus; Oligurie; Oxyurid; Parasiten; Prellungen und Blutergüsse; Psychosen; Rheumatismus; Ruhr; Rückenschmerzen; SAD; Schlafstörungen; Schlaganfall; Schlangenbisse; Schmerzen; Schnittwunden; Sonnenbrand; Staphylococcus; Strahlung; Streptococcus; Stress; Tetanus; Tollwut; Tuberkulose; Ulcus cruris; Unfruchtbarkeit; Venenentzündungen; Verdauungsstörungen; Verkühlungen Schmerzen; Verstauchungen; Verstärkte Regelblutungen; Virale Hepatitis; Virus; Vitiligo; Wahn; Wassereinlagerungen; Wechseljahre; Windpocken; Wunden; Würmer; Zerrungen; Zwölffingerdarmentzündung;
Dosierung:
2–4 g trockenes Kraut (0,2–1 mg Hypericin)/täglich;
2–5 g trockenes Kraut/Tag;
2–4 ml flüssiger Krautextrakt;
2–4 g trockene Triebe, in Tee, 3 ×/Tag;
1–2 Teelöffel (2–4 g Blüten)/Tasse Wasser 1–2 ×/Tag für 4–6 Wochen;
2–4 ml flüssiger Blütenextrakt 1:1 in 25% Alkohol 3 ×/Tag;
2–4 ml Blütentinktur 1:10 in 45% Alkohol 3 ×/Tag;
1–2 ml Blütentinktur 3 ×/Tag;
Wirkung tritt erst oft nach 2–3 Wochen ein. Auf eine ausreichende
Tagesdosis ist zu achten: bei leichten depressiven Verstimmungen
300–900 mg Extrakt, bei mittelschweren depressiven Episoden mindestens 900 mg Extrakt pro Tag.
In der Homöopathie; bis dil. D 1.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Kann Wirkung von MAO-Hemmern potenzieren.
Aktive Inhaltsstoffe können photoaktiv, besonders bei hellhäutigen Personen, sein. Obwohl Johanniskraut nicht so stark wirkt wie synthetische MAO-Hemmer sollte man bei Einnahme folgende Produkte vermeiden: hoch Tyramin-haltige Lebensmittel, wie gebeizte oder geräucherte Produkte, alkoholische Getränke, Amphetamine, Erkältungsmittel und Mittel gegen Heuschnupfen, Betäubungsmittel, Tryptophan und Tyrosin.
Nicht während Schwangerschaft, Stillzeit oder intensiver Sonneneinstrahlung.
Johanniskraut sollte nicht mit synthetischen Antidepressiva gemischt werden.
Wie synthetische Antidepressiva, kann es Hypomanie bei manischen Patienten induzieren.
Johanniskraut kann wahrscheinlich die Fruchtbarkeit stören.
Johanniskraut sollte nicht am Abend angewendet werden.
Speisewert:
Medizinisch
9 Bild(er) für diese Pflanze
Abmessungen:
Pflanze Höhe : 30.00 ... 60.00 cm xFrucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher
Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher  Kletterpflanzen, Lianen
Kletterpflanzen, Lianen  Milchsaft vorhanden
Milchsaft vorhanden  Stacheln an Stamm oder Blatt
Stacheln an Stamm oder Blatt Blütezeit
 Blütezeit Juni - 06
Blütezeit Juni - 06Pflanze Jährigkeit
 Mehrjährig
MehrjährigHaare
 Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig
Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig  Haare verzweigt
Haare verzweigt Blätter
 Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)
Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)
Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)  Blätter mit durchsichtigen oder drüsigen Punkten oder Linien
Blätter mit durchsichtigen oder drüsigen Punkten oder Linien  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand eine Rispe, einfach und monopodial
Blütenstand eine Rispe, einfach und monopodial  Blütenstand ein Büschel, einfach und monopodial
Blütenstand ein Büschel, einfach und monopodial  Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)
Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 bisexuell
bisexuell  unisexual
unisexual  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)  Blütenboden vergrössert, konisch oder kalbkugelförmig (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden vergrössert, konisch oder kalbkugelförmig (oberständiger Fruchtknoten)  Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)
Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6  Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6  Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten
Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 2
Kelchblätter 2  Kelchblätter 3
Kelchblätter 3  Kelchblätter 4
Kelchblätter 4  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter mehr als 5
Kelchblätter mehr als 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter schuppig oder verzerrt
Kelchblätter schuppig oder verzerrt  Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt
Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt  Blütenblätter 2
Blütenblätter 2  Blütenblätter 3
Blütenblätter 3  Blütenblätter 4
Blütenblätter 4  Blütenblätter 5
Blütenblätter 5  Blütenblätter 6
Blütenblätter 6  Blütenblätter 8
Blütenblätter 8  Blütenblätter 10
Blütenblätter 10  Blütenblätter alle frei voneinander
Blütenblätter alle frei voneinander  Blütenblätter schuppig
Blütenblätter schuppig  Blütenblätter verzerrten
Blütenblätter verzerrten  Blütenblätter hüllig oder becherig
Blütenblätter hüllig oder becherig  Staubbeutel 4, fruchtbar
Staubbeutel 4, fruchtbar  Staubbeutel 5, fruchtbar
Staubbeutel 5, fruchtbar  Staubbeutel 6, fruchtbar
Staubbeutel 6, fruchtbar  Staubbeutel 8, fruchtbar
Staubbeutel 8, fruchtbar  Staubbeutel 10, fruchtbar
Staubbeutel 10, fruchtbar  Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar
Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel nach Aussen gerichtet
Staubbeutel nach Aussen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel
Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel  Staubfäden verwachsen - in getrennten Bündeln
Staubfäden verwachsen - in getrennten Bündeln  Stiele fehlend, Narben direkt aufsitzend
Stiele fehlend, Narben direkt aufsitzend  Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)
Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Fruchtblatt 1
Fruchtblatt 1  Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  Fruchknoten 2-kammerig
Fruchknoten 2-kammerig  Fruchknoten 3-kammerig
Fruchknoten 3-kammerig  Fruchknoten 4-kammerig
Fruchknoten 4-kammerig  Fruchknoten 5-kammerig
Fruchknoten 5-kammerig  Fruchknoten mehr als 5-kammerig
Fruchknoten mehr als 5-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  2 Samen pro Fruchtkammer
2 Samen pro Fruchtkammer  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Fruchtblätter frei von einander oder 1 Fruchtblatt
Fruchtblätter frei von einander oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen seitlich, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen seitlich, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)
Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)  Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)
Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)  Frucht hat 1 Samen
Frucht hat 1 Samen  Frucht hat 2 Samen
Frucht hat 2 Samen  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Samen mit Flügeln
Samen mit Flügeln  Samenmantel oder mantelähnliche Organe vorhanden
Samenmantel oder mantelähnliche Organe vorhanden  Keim gerade
Keim gerade  Keim gekrümmt
Keim gekrümmt  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Australien und Ozeanien
Australien und Ozeanien  Europa
Europa  Nordamerika
Nordamerika  Südamerika
Südamerika  Previous
Previous