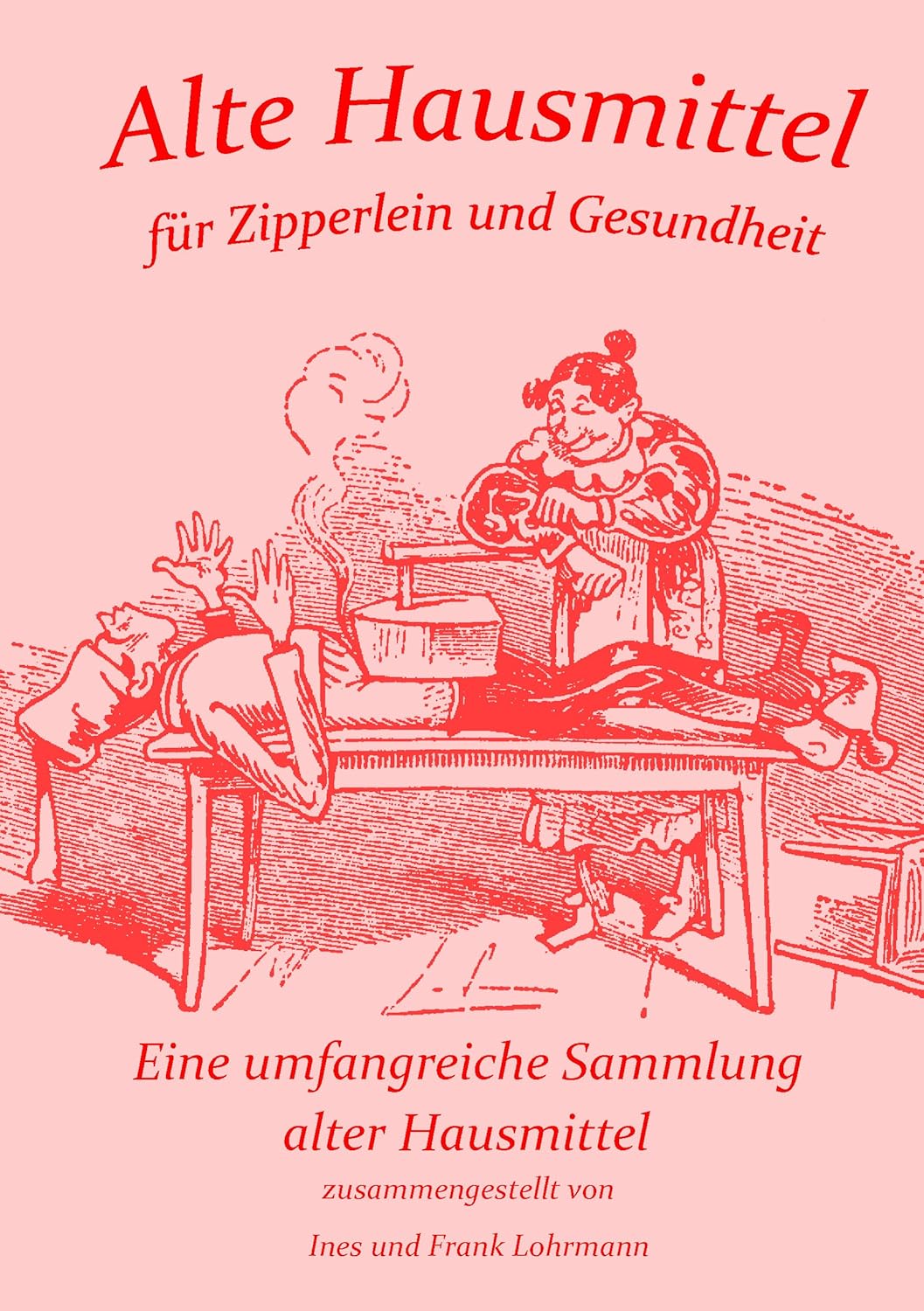Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Spitzlappiger Frauenmantel - Alchemilla vulgaris L.
Englisch: Lady’s Mantle
Französisch: Manteau de Notre-Dame, pied de Lion
Italienisch: Alchemilla, erba stella, Erba ventaglina

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Frauenmantel
Gemeiner Frauenmantel
Gemeiner Sinau
Gewöhnlicher Frauenmantel
Löwenklau
Mantelkraut
Milchkraut
Parisol
Sonnenblätter
Spitzlappiger Frauenmantel
Thumantel
Synonyme :
Alchemilla acutangula Buser
Alchemilla acutangula var. adpressepilosa H.Lindb.
Alchemilla acutiloba Buser
Alchemilla acutiloba Opiz
Alchemilla acutiloba Stev.
Alchemilla acutiloba f. acutiloba
Alchemilla acutiloba f. adpressepilosa (H.Lindb.) Hyl.
Alchemilla acutiloba f. adpressepilosa (H.Lindb.) Hyl. ex Sam.
Alchemilla acutiloba f. intonsa S.E.Fröhner
Alchemilla acutiloba var. acutiloba
Alchemilla acutiloba var. pontica Buser
Alchemilla acutiloba var. stellata Poelt
Alchemilla latifolia Salisb.
Alchemilla palmata subsp. acutangula (Buser) Soó & Palitz
Alchemilla pontica (Buser) F.Malý
Alchemilla pontica (Buser) K.Malý
Alchemilla sylvestris var. acutangula (Buser) Hayek
Alchemilla vulgaris subsp. acutangula (Buser) Murb.
Alchemilla vulgaris subsp. acutangula (Buser) Palitz
Alchemilla vulgaris subsp. acutiloba (Opiz) Dostál
Alchemilla vulgaris subsp. assurgens Braun-Blanq.
Alchemilla vulgaris subsp. vulgaris
Alchemilla vulgaris var. acutangula (Buser) Asch. & Graebn.
Alchemilla vulgaris var. acutangula (Buser) Paulin
Alchemilla vulgaris var. acutangula (Buser) R.Keller
Alchemilla vulgaris var. acutiloba (Opiz) Stoj. et al.
Alchemilla vulgaris var. strigulosa (Buser) Briq.
Potentilla acutiloba (Opiz) Christenh. & Väre
Blatt: Blätter fünf- bis neunlappig oder ebensoviel-teilig. Meist vier-, selten zwei-männig. Blätter nicht bis zum Grunde geteilt. Blätter etwa bis zum dritten Teil fünf- bis neunspaltig, im Umrisse nierenförmig oder rundlich, mit halbkreisrunden, eiförmigen oder länglichen, gesägten Lappen.
Stengel bzw. Stamm: 30 cm hohe Halbrosettenstaude mit kahlen bis dicht zottig behaarten Sprossen
Blüte: Blüten grünlichgelb; meist getrennten Geschlechtes; zwitterige Pflanzen fehlen streckenweise gänzlich. Blütezeit Mai bis Herbst. Erstweiblich.
Vorkommen: Heimat: temperiertes Europa bis zum Ob, Nordrussland, Holland, Rhein, West-Schweiz.
Er vermehrt sich nur ungeschlechtlich, da seine Blüten unfruchtbar sind und er verfettet auf gedüngten Wiesen sehr schnell.
In Wäldern, auf Wiesen; meist gemein, auf frischem humösem und dungkräftigem Boden.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Die Pflanze ist ein Lieblingsfutter der Pferde.
Blätter: roh als Salat, Suppen, Würze, als Tee, Gemüsefüllung, gekocht als Gemüse, Auflauf, Trockengemüse
Das Kraut – Alchemillae herba - ist offizinell und wird bei Durchfallerkrankungen verwendet.
Volksmedizin:
Der Frauenmantel war schon bei den Germanen sehr geschätzt, die die Pflanze der Frigga, der Göttin der Natur und ihrer Fruchtbarkeit, geheiligt hatten und sie zur Zeit des abnehmenden Mondes zu gewissen Heilzwecken benutzten. In Schweden ist sie seit alten Zeiten als Mittel gegen Ergotismus im Volke gebräuchlich.
Als mit der zunehmenden Christianisierung die Göttin Frigga durch
die Jungfrau Maria abgelöst wurde, wandelte sich auch der Frauenmantel als Marienmantel in ein Unser lieben Frawen zugehöriges Marienblümchen um.
Der schweizer Kräuterpfarrer Künzle schreibt:
„Das Frauenmänteli stärkt die Muskeln der Frauen in geradezu auffallender Weise. Einer Frau im Glarnerland, welche schon 10 Geburten durchgemacht hatte, wobei die letzten drei sie zwischen Leben und Tod brachten, prophezeiten die Ärzte, die 11. Geburt
werde ihr den sicheren Tod bringen. Diese 11. Geburt kam wirklich,
brachte jedoch keineswegs den Tod, war auch keine Fehlgeburt, sondern die leichteste und beste von allen elfen, und das Kind war das schönste und stärkste von allen; wie war dies nun gekommen. Die gute Frau hatte auf den Rat eines Kräutermannes vom dritten Monat an täglich eine Tasse Frauenmänteli getrunken."
Die russische Volksmedizin verwendet den Frauenmantel in gleicher Weise.
Hildegard von Bingen empfahl ihn besonders gegen Kehlgeschwüre. Doch auch als Adstringens, Emmenagogum, Diuretikum, zu Mundwässern, Bädern, Umschlägen usw. ist er verwandt worden.
Die Esten schreiben dem Tau, der sich auf den Blättern der Pflanze sammelt, eine heilende Wirkung bei Augenentzündungen zu, und in der Schweiz gilt das Waschen mit den betauten Blättern als gutes Mittel zum Vertreiben der Sommersprossen.
Medizinisch:
Studien weisen auf Wirksamkeit gegen Karzinome des weiblichen Genitalbereichs hin.
Aktivität:
Antioxidant; Antitumor; Aperitif; Blutung stillend; Chymotrypsin Inhibitor; Elastase Inhibitor; Entwässernd; Entzündungshemmend; Erbgutverändernd; Fungizid; Gesundheit schützend; Muskelrelaxans; Trypsin Inhibitor; Zusammenziehend;
Indikation:
Appetitlosigkeit; Ausfluss; Blutungen; Darmentzündungen; Dermatosen; Durchfall; Ekzeme und Neurodermitis; Entzündungen; Halsschmerzen; Hautausschlag; Hepatose; Infektion; Krebs; Krämpfe; Magenerkrankungen; Magersucht; Menopause; Menstruationsbeschwerden; Mundfäule; Pilze; Pilzinfektionen; Prellungen und Blutergüsse; Rachenentzündung; Schmerzen; Tumor; Vaginose; Verstärkte Regelblutungen; Vulvitis; Wassereinlagerungen;
Dosierung:
1–2 Teelöffel (1–2 g) Kraut/Tasse Wasser;
2–4 g/Kraut/Tasse Tee;
5–10 g Kraut;
2–4 ml flüssiger Kraut Extrakt.
In der Homöopathie: bis dil. D 2, dreimal täglich 10 Tropfen.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Enthält Tannin.
Speisewert:
Medizinisch
1 Bild(er) für diese Pflanze
Alchemilla vulgaris © Anne Tanne @ Belgium |
Abmessungen:
Pflanze Höhe : 15.00 ... 30.00 cm xFrucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher
Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher  Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher  Kletterpflanzen, Lianen
Kletterpflanzen, Lianen  Stacheln an Stamm oder Blatt
Stacheln an Stamm oder Blatt Blütezeit
 Blütezeit Mai - 05
Blütezeit Mai - 05 Blütezeit Juni - 06
Blütezeit Juni - 06 Blütezeit Juli - 07
Blütezeit Juli - 07  Blütezeit August - 08
Blütezeit August - 08  Blütezeit September - 09
Blütezeit September - 09  Blütezeit Oktober - 10
Blütezeit Oktober - 10 Pflanze Jährigkeit
 Einjährig
EinjährigHaare
 Haare drüsig, warzig
Haare drüsig, warzig  Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig
Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig  Haare Sternzellig (nicht 2-armig, verzweigt oder federig)
Haare Sternzellig (nicht 2-armig, verzweigt oder federig)  Haare federig, aber nicht drüsig
Haare federig, aber nicht drüsig  Haare schildförmig oder schuppig
Haare schildförmig oder schuppig Blätter
 Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)
Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)  Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter schildförmig
Blätter schildförmig  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Blätter mehrteilig, verzweigt, kompliziert
Blätter mehrteilig, verzweigt, kompliziert  Blätter gefiedert (4 oder mehr Blätter)
Blätter gefiedert (4 oder mehr Blätter)  Blätter 3-teilig
Blätter 3-teilig  Blätter handförmig (4 oder mehr Teile)
Blätter handförmig (4 oder mehr Teile)  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Aderung handförmig in Blätter oder Blatteile
Aderung handförmig in Blätter oder Blatteile  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt
Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt  Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.
Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.  Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)
Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen  Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind)
Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind) Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand eine Rispe, einfach und monopodial
Blütenstand eine Rispe, einfach und monopodial  Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial
Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial  Blutenstand eine Doldentraube, einfach und monopodial
Blutenstand eine Doldentraube, einfach und monopodial  Blütenstand eine Dolde, einfach und monopodial
Blütenstand eine Dolde, einfach und monopodial  Blütenstand ein Büschel, einfach und monopodial
Blütenstand ein Büschel, einfach und monopodial  Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial
Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 bisexuell
bisexuell  unisexual
unisexual  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig
zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig  Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend
Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend  Blütenboden vergrössert, ganz oder teilweise frei vom Fruchtknoten
Blütenboden vergrössert, ganz oder teilweise frei vom Fruchtknoten  Blütenboden vergrössert, konisch oder kalbkugelförmig (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden vergrössert, konisch oder kalbkugelförmig (oberständiger Fruchtknoten)  Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)
Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 3
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 3  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6  Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6  Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten
Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 3
Kelchblätter 3  Kelchblätter 4
Kelchblätter 4  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter mehr als 5
Kelchblätter mehr als 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter schuppig oder verzerrt
Kelchblätter schuppig oder verzerrt  Blütenblätter 0 (inkl. Einem becherartigen Blütenkrone ohne Blätter)
Blütenblätter 0 (inkl. Einem becherartigen Blütenkrone ohne Blätter)  Blütenblätter 3
Blütenblätter 3  Blütenblätter 4
Blütenblätter 4  Blütenblätter 5
Blütenblätter 5  Blütenblätter 6
Blütenblätter 6  Blütenblätter 7
Blütenblätter 7  Blütenblätter 8
Blütenblätter 8  Blütenblätter 9
Blütenblätter 9  Blütenblätter 10
Blütenblätter 10  Blütenblätter mehr als 10
Blütenblätter mehr als 10  Blütenblätter alle frei voneinander
Blütenblätter alle frei voneinander  Blütenblätter schuppig
Blütenblätter schuppig  Blütenblätter verzerrten
Blütenblätter verzerrten  Staubbeutel 1, fruchtbar
Staubbeutel 1, fruchtbar  Staubbeutel 2, fruchtbar
Staubbeutel 2, fruchtbar  Staubbeutel 4, fruchtbar
Staubbeutel 4, fruchtbar  Staubbeutel 5, fruchtbar
Staubbeutel 5, fruchtbar  Staubbeutel 8, fruchtbar
Staubbeutel 8, fruchtbar  Staubbeutel 10, fruchtbar
Staubbeutel 10, fruchtbar  Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar
Staubbeutel mehr als 10, fruchtbar  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel nach Aussen gerichtet
Staubbeutel nach Aussen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubbeutel durch die Spitze öffnend
Staubbeutel durch die Spitze öffnend  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel
Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel  Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)
Sterile Staubblätter vorhanden (nur bei männlichen oder pferfekten Blüten)  Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)
Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Stempel gynobase entspringend
Stempel gynobase entspringend  Fruchtblatt 1
Fruchtblatt 1  Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  Fruchknoten 2-kammerig
Fruchknoten 2-kammerig  Fruchknoten 3-kammerig
Fruchknoten 3-kammerig  Fruchknoten 4-kammerig
Fruchknoten 4-kammerig  Fruchknoten 5-kammerig
Fruchknoten 5-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  2 Samen pro Fruchtkammer
2 Samen pro Fruchtkammer  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Fruchtblätter frei von einander oder 1 Fruchtblatt
Fruchtblätter frei von einander oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt  Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)
Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)  Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)
Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)  Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)
Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)  Frucht hat 1 Samen
Frucht hat 1 Samen  Frucht hat 2 Samen
Frucht hat 2 Samen  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Frucht mit Flügeln
Frucht mit Flügeln  Frucht mit Haaren zur Windverbreitung
Frucht mit Haaren zur Windverbreitung  Frucht mit rückgebogenen Stacheln, hakenförmige oder widerhakenförmige Haare
Frucht mit rückgebogenen Stacheln, hakenförmige oder widerhakenförmige Haare  Frucht mit Stacheln und Haken
Frucht mit Stacheln und Haken  Samen mit Flügeln
Samen mit Flügeln  Keim gerade
Keim gerade  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe  Samen mit Nährgewebe
Samen mit Nährgewebe Verbreitung
 Afrika
Afrika  Asien
Asien  Australien und Ozeanien
Australien und Ozeanien  Europa
Europa  Nordamerika
Nordamerika  Südamerika
Südamerika  Previous
Previous