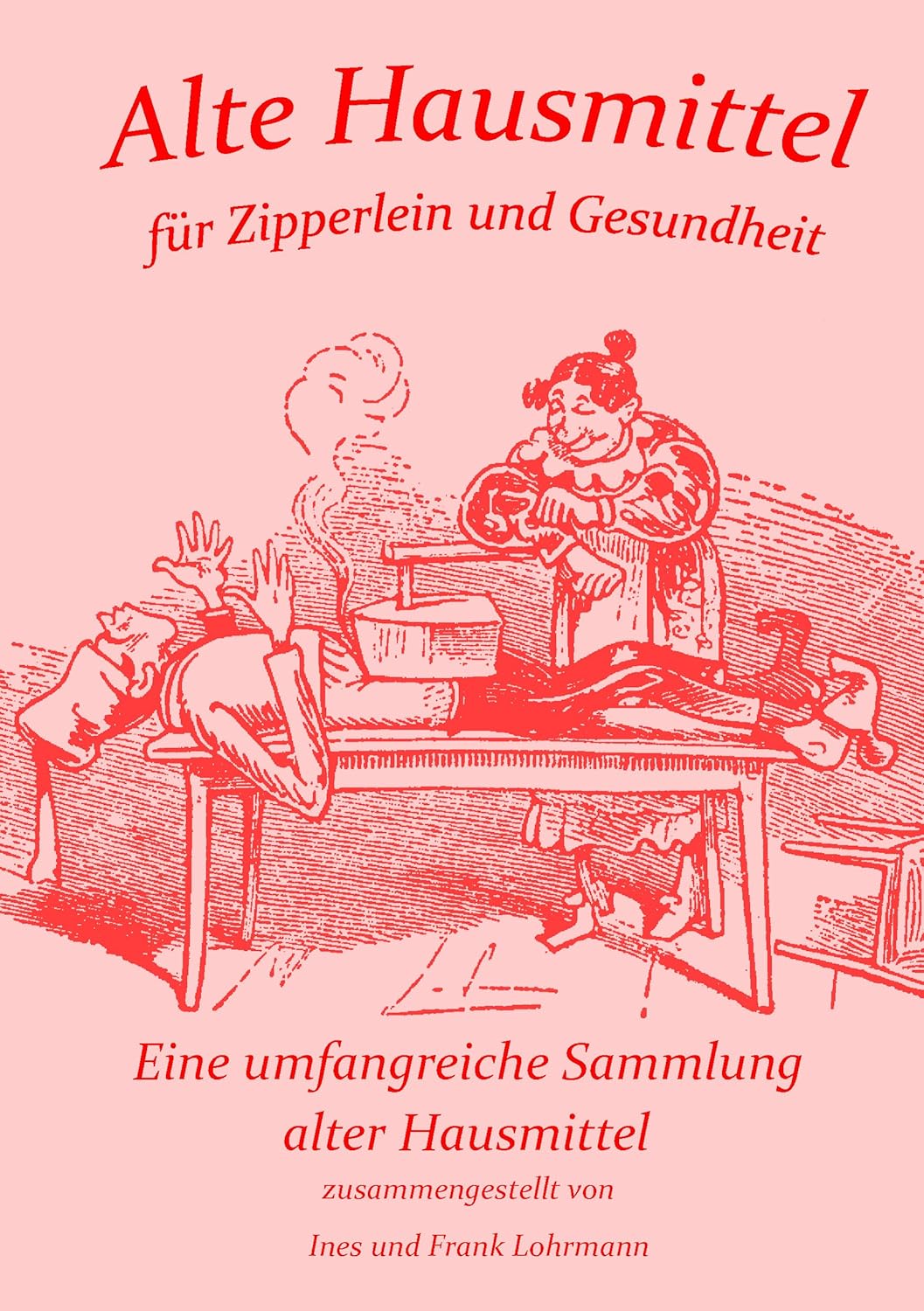Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Kletten-Labkraut - Galium aparine L.
Englisch: Airif, Bedstraw, Bed straw, Beggar-lice, Beggar lice, Beggarlice, Beggarslice, Beggar’s-lice, Bird-lime, Bird lime, Bur-head, Bur-weed, Burhead, Burrhead, Burrweed, Burr weed, Bur weed, Burweed, Catch-weed, Catchweed, Catch weed, catchweed bedstraw, Cheese rennet-herb, Cheese rennet herb, Clabber-grass, Clabbergrass, Claver-grass, Claver grass, Clayver-grass, Cleaver, Cleaver-wort, cleavers, Cleavers’ goose-grass, Cleaverwort, Cleaver wort, Cling-rascal, Cling rascal, Clivers, Clyuers, Clyvers, Common cleavers, Galium, Goose-grass, Goose grass, Gooses hare, Goose’s-hare, Gosling-weed, Gosling weed, Grip, Grip-grass, Grip grass, Hairif, Harvest-lice, Harvestlice, Harvest lice, Ladies’ bedstraw, Lady’s-bedstraw, Lady’s bedstraw, Lady’s bedstraws, Love-man, Loveman, Maids’ hair, Milksweet, Milk sweet, partridge berry), Pertimugget, Pig tail, Pigtail, Poor-robin, Poor Robin, Savoyan, Scratch-grass, Scratch-weed, Scratch grass, Scratch weed, Snatch-weed, Stick-a-back, Stickaback, Stickle-back, Stickleback, Sticky-willy, stickywilly, Sweet-hearts, Sweetheart, Sweethearts, Turkey-grass, Turkey grass, Vail lantii goose-grass, Vaillantii goosegrass, Wild hedge-burs, Wild hedge bur, Wild rose mary
Spanisch: amor de hortelano
Französisch: Gaillet gratteron, gratteron rieble gleton, Rièbel
Russisch: подмаренник цепкий
China: 八重潷 bāzhbnglü, 垃垃藤 lālāténg

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Artengruppe Kletten-Labkraut
Gewöhnliches Klebkraut
Gewöhnliches Kletten-Labkraut
Klebern
Klebkraut
Klebriges Labkraut
Kletten Labkraut
Kletten-Labkraut
Klettenlabkraut
Kletterndes Klebkraut
Kletterndes Labkraut
Klettlabkraut
Zaunreis
Synonyme :
Aparine hispida Moench
Aparine vulgaris Delarbre
Aparine vulgaris Hill
Asperula aparine (L.) Besser
Asperula aparine var. aparine
Asperula aparine var. aparine (L.) Nyman
Asterophyllum aparine (L.) K.F.Schimp. & Spenn.
Asterophyllum aparine (L.) Schimp. & Spenn.
Crucianella purpurea Wulff ex Steud.
Galion aparinum (L.) St.-Lag.
Galium aculeatissimum Kit.
Galium aculeatissimum Kit. ex Kanitz
Galium adhaerens Gilib.
Galium agreste Wallr.
Galium aparine f. intermedium (Mérat) R.J.Moore
Galium aparine subsp. agreste P.D.Sell
Galium aparine var. agreste P.D.Sell
Galium aparine var. echinospermum (Wallr.) T.Durand
Galium aparine var. fructibushispidis Franch.
Galium aparine var. hirsutum Mert. & W.D.J.Koch
Galium aparine var. intermedium (Merr.) Briq.
Galium aparine var. intermedium (Mérat) Bonnet
Galium aparine var. marinum Fr.
Galium aparine var. microphyllum Clos
Galium aparine var. minor Hook.
Galium aparine var. pseudoaparine (Griseb.) Speg.
Galium aparine var. subglabrum Peterm.
Galium aparine var. verum Wimm. & Grab.
Galium asperum Honck.
Galium australe Reiche
Galium borbonicum var. makianum Cordem.
Galium charoides Rusby
Galium chilense Hook.f.
Galium chonosense Clos
Galium hispidum Willd.
Galium horridum Eckl. & Zeyh.
Galium intermedium Mérat
Galium lappaceum Salisb.
Galium larecajense Wernham
Galium oliganthum Nakai & Kitag.
Galium parviflorum Maxim.
Galium pauciflorum Bunge
Galium pseudoaparine Griseb.
Galium scaberrimum Vahl ex Hornem.
Galium segetum K.Koch
Galium spurium var. echinospermum (Wallr.) Desp.
Galium spurium var. echinospermum (Wallr.) Hayek
Galium spurium var. echinospermum Desp.
Galium tenerrimum Schur
Galium uliginosum Thunb.
Galium uncinatum Gray
Rubia aparine (L.) Baill.
Valantia aparine (L.) Lam.
Blatt: Blüten zuletzt fast rispig-trugdoldig. Pflanze nicht nach Cumarin duftend. Blattrand durch nach dem Blattgrunde gerichtete, kleine Stachelchen rauh. Blätter lineal-lanzettlich, stachelspitzig.
Stengel bzw. Stamm: Wurzel spindelförmig, einjährig. Stengel kletternd, 60 bis 125 cm lang. Der liegende oder kletternde, vierkantige Stengel ist kahl und nur an den Gelenken verdickt und steifhaarig.
Blüte: Blumenkrone klein, weiss oder grünlich. Blütezeit Juni, Oktober; vorstäubend.
Frucht bzw. Samen: Frucht warzig bis hakenborstig, selten kahl, nach völliger Entwicklung breiter alsdie Blumenkrone.
Vorkommen: Auf Ackern, an Zäunen, in Gebüschen: lästiges Unkraut. in Eurasien heimische, in Amerika eingeschleppt.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Die Pflanze wird von allen Tieren mit Ausnahme von Schweinen gefressen. Ganz besonders wird sie von jungen Gänsen geschätzt, daher der in England volkstümliche Name „goose-grass". Die Früchte und anderen Arten der Gattung sind in den neolithischen Pfahlbauten in so großen Mengen nachgewiesen worden, daß die Vermutung naheliegt, daß sie von prähistorischen Menschen verwendet worden sind, und zwar wahrscheinlich zur Käsebereitung als Labferment, wie dies noch heute in einigen Gegenden Englands üblich ist. Im griechischen und römischen Altertum war das Klebkraut als Heilmittel bereits bekannt und wurde mit Wein getrunken gegen Spinnen- und Schlangenbisse, äußerlich gegen Ohrenschmerzen und als drüsenverteilendes Mittel gebraucht. Aus den Schriften der Antike schöpfen die Kräuterbücher des Mittelalters, die die Pflanze in ähnlicher Weise empfehlen. Herba Galii aparinis wurde besonders bei Wassersucht, Leber- und Hautkrankheiten, Kropf und Skrofulöse gerühmt. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Saft gegen Skorbut und Krebs empfohlen, wozu er in großen Dosen innerlich genommen und äußerlich in Salbenform angewendet werden sollte. Bei den Slowaken trinkt man nach Genuss eines Abführmittels eine Abkochung des Labkrautes gegen den Krebs. In Irland wurden die Früchte als Kaffeeersatz verwendet.
Genussmittel, Nahrungsmittel:
Samen: als Kaffeeersatz, geröstet als Knabberei
Triebe: gedämpft als Gemüse, Tee
Blüten: Gemüse, Tee
Mittlerweile gilt die Pflanze als giftig.
Medizinisch:
Im griechischen und römischen Altertum war das Klebkraut als Heilmittel bereits bekannt und wurde mit Wein getrunken gegen Spinnen- und Schlangenbisse, äußerlich gegen Ohrenschmerzen und als drüsenverteilendes Mittel gebraucht. Aus den Schriften der Antike schöpfen die Kräuterbücher des Mittelalters, die
die Pflanze in ähnlicher Weise empfehlen. Herba Galii aparinis wurde besonders bei Wassersucht, Leber- und Hautkrankheiten, Kropf und Skrofulöse gerühmt. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Saft gegen Skorbut und Krebs empfohlen, wozu er in großen Dosen innerlich genommen und äußerlich in Salbenform angewendet werden sollte.
Bei den Slowaken trinkt man nach Genuss eines Abführmittels eine Abkochung des Labkrautes gegen den Krebs. In Irland wurden die Früchte als Kaffeeersatz verwendet.
In Asien werden die Blätter bei Ikterus innerlich verwendet. Äußerlich werden sie bei Verletzungen und Wunden als Antiseptikum verwendet. Sie dienen dort auch der Behandlung von Krebs.
Studien weisen auf Wirksamkeit gegen Zungenkrebs hin.
Aktivität:
Abführend; Antibakteriell; Antidyscratisch; Blutdrucksenkend; Blutung stillend; Brechreizend; Entwässernd; Entzündungshemmend; Fiebersenkend; Giftig; Immunstimulans; Krampflindernd; Kräftigend, Stärkend; Larvizid und Larventötend; Lymphsystem Kräftigend, Stärkend; Menstruationsfördernd; Reinigend; Reizlindernd; Schweißtreibend; Steinauflösend; Stimmungsverändernd; Zusammenziehend;
Indikation:
Ausbleibende Menstruation; Aussatz; Bakterien; Bauchwassersucht; Bisse; Bluthochdruck; Bluthusten; Blutsturz; Blutungen; Brustknoten; Brustkrebs; Dermatosen; Drüsenkrebs; Einnässen; Ekzeme Krätze und Juckreiz; Ekzeme und Neurodermitis; Entzündungen; Epilepsie; Exanthem; Fettleibigkeit; Fieber; Gallenblasenentzündung; Gelbsucht; Geschwülste; Gewebeverhärtung; Gicht; Giftsumach-Vergiftung; Gonorrhoe; Grieß in Blase oder Niere; Halsdrüsengeschwulst; Halskrebs; Harnblasenentzündungen; Harnstrenge; Hautkrebs; Hefeinfektionen; Hepatom; Hysterie; Hörprobleme; Immunodepression; Ischurie; Katarrh; Krebs; Krämpfe; Körner; Leukämie; Lichen; Lithiasis; Lungentuberkulose; Lymphadenitis; Lymphdrüsenerkrankungen; Magenerkrankungen; Magengeschwüre und Darmgeschwüre; Mandelentzündung; Mundfäule; Nasenbluten; Nierensteine; Pocken; Psychosen; Scharlach; Schmerzen; Schuppenflechte; Schüttelfrost; Sommersprossen und Hautflecken; Steine; Talgzysten; Tuberkulose; Verstopfung; Wassereinlagerungen; Wassersucht; Wunden; Zungenkrebs;
Dosierung:
5–10 ml Kraut Tinktur 3 ×/Tag;
2–4 g Kraut als Tee 3 ×/Tag;
2–4 ml Flüssigextrakt 1:1 in 25% Alkohol 3 ×/Tag;
2–4 ml flüssiger Kraut-Extrakt;
3–15 ml gepresster Saft 3 ×/Tag;
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Diabetiker sollten den ausgepressten Saft nur mit Vorsicht verwenden. Übermäßige Verwendung sollte vermieden werden, besonders während der Schwangerschaft. Senkt den arteriellen Blutdruck ohne Verlangsamung der Herzfrequenz.
Wirkt mild abführend.
Speisewert:
Medizinisch
4 Bild(er) für diese Pflanze
Galium aparine © Matt Lavin @ flickr.com |
Galium aparine © Matt Lavin @ flickr.com |
Galium aparine © Matt Lavin @ flickr.com |
Galium aparine © Anne Tanne @ Belgium |
Abmessungen:
Pflanze Höhe : 50.00 ... 130.00 cm xFrucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher
Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher  Krautige Pflanzen, Halbsträucher
Krautige Pflanzen, Halbsträucher  Kletterpflanzen, Lianen
Kletterpflanzen, Lianen  Stacheln an Stamm oder Blatt
Stacheln an Stamm oder Blatt Blütezeit
 Blütezeit Juni - 06
Blütezeit Juni - 06 Blütezeit Juli - 07
Blütezeit Juli - 07  Blütezeit August - 08
Blütezeit August - 08  Blütezeit September - 09
Blütezeit September - 09  Blütezeit Oktober - 10
Blütezeit Oktober - 10 Pflanze Jährigkeit
 Einjährig
EinjährigHaare
 Haare drüsig, warzig
Haare drüsig, warzig  Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig
Haare Sternzellig, auch 2-armig, verzweigt oder federig  Haare Sternzellig (nicht 2-armig, verzweigt oder federig)
Haare Sternzellig (nicht 2-armig, verzweigt oder federig)  Haare federig, aber nicht drüsig
Haare federig, aber nicht drüsig  Haare schildförmig oder schuppig
Haare schildförmig oder schuppig Blätter
 Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)
Blätter gegenständig oder wirtelig (quirlig)  Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter schildförmig
Blätter schildförmig  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt
Geadert, gefiedert oder kaum sichtbar in Blätter oder Teile geteilt  Aderung in Längsblätter oder Teile (inkl. 3-teilige Blätter)
Aderung in Längsblätter oder Teile (inkl. 3-teilige Blätter)  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt
Blätter oder Blatteile gelappt oder geteilt  Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.
Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.  Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)
Epidermid des Blattes papillös (nur Zweikeimblättrige)  Blätter mit durchsichtigen oder drüsigen Punkten oder Linien
Blätter mit durchsichtigen oder drüsigen Punkten oder Linien  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen  Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind)
Nebenblätter vorhanden (auch, wenn nur noch Narben zu sehen sind) Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial
Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial  Blütenstand eine Dolde, einfach und monopodial
Blütenstand eine Dolde, einfach und monopodial  Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial
Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial  Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)
Blütenstand einfach und sympodial (Zyme, Wickel, Verzweigt)  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 bisexuell
bisexuell  unisexual
unisexual  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig
zygomorph, dorsiventral oder monosymmetrisch oder unregelmässig  Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)  Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend
Blütenboden vergrössert, vereint mit Fruchtknoten, diesen ganz oder teilweise bedeckend  Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)
Staubgefässe vorhanden (Ringförmig oder Drüsen)  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 4  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 5  Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente:> 6  Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten
Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 0 (inkl. 1 becherartiger Kelch ohne Lappen)
Kelchblätter 0 (inkl. 1 becherartiger Kelch ohne Lappen)  Kelchblätter 3
Kelchblätter 3  Kelchblätter 4
Kelchblätter 4  Kelchblätter 5
Kelchblätter 5  Kelchblätter mehr als 5
Kelchblätter mehr als 5  Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)
Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)  Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt
Kelchblätter röhrig oder zusammengelegt  Blütenblätter 4
Blütenblätter 4  Blütenblätter 5
Blütenblätter 5  Blütenblätter 6
Blütenblätter 6  Blütenblätter 7
Blütenblätter 7  Blütenblätter 8
Blütenblätter 8  Blütenblätter 9
Blütenblätter 9  Blütenblätter 10
Blütenblätter 10  Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)
Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)  Blütenblätter schuppig
Blütenblätter schuppig  Blütenblätter verzerrten
Blütenblätter verzerrten  Blütenblätter hüllig oder becherig
Blütenblätter hüllig oder becherig  Staubbeutel 1, fruchtbar
Staubbeutel 1, fruchtbar  Staubbeutel 2, fruchtbar
Staubbeutel 2, fruchtbar  Staubbeutel 3, fruchtbar
Staubbeutel 3, fruchtbar  Staubbeutel 4, fruchtbar
Staubbeutel 4, fruchtbar  Staubbeutel 5, fruchtbar
Staubbeutel 5, fruchtbar  Staubbeutel 6, fruchtbar
Staubbeutel 6, fruchtbar  Staubbeutel 7, fruchtbar
Staubbeutel 7, fruchtbar  Staubbeutel 8, fruchtbar
Staubbeutel 8, fruchtbar  Staubbeutel 9, fruchtbar
Staubbeutel 9, fruchtbar  Staubbeutel 10, fruchtbar
Staubbeutel 10, fruchtbar  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel nach Aussen gerichtet
Staubbeutel nach Aussen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubbeutel durch die Spitze öffnend
Staubbeutel durch die Spitze öffnend  Staubbeutel röhrig öffnend
Staubbeutel röhrig öffnend  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubblätter in die Krone eingefügt
Staubblätter in die Krone eingefügt  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel
Staubfäden verwachsen - EIn Rohr oder ein Bündel  Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)
Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 2 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 4 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 5 (frei oder vereinigt)  Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter mehr als 5 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  Fruchknoten 2-kammerig
Fruchknoten 2-kammerig  Fruchknoten 3-kammerig
Fruchknoten 3-kammerig  Fruchknoten 4-kammerig
Fruchknoten 4-kammerig  Fruchknoten 5-kammerig
Fruchknoten 5-kammerig  Fruchknoten mehr als 5-kammerig
Fruchknoten mehr als 5-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  2 Samen pro Fruchtkammer
2 Samen pro Fruchtkammer  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Samenanlagen seitlich, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen seitlich, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Spitze des Fruchtknotens befestigt  Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)
Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)  Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)
Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)  Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)
Frucht ist fleischig (Beeren, Steinfrüchte, Kernobst)  Frucht hat 1 Samen
Frucht hat 1 Samen  Frucht hat 2 Samen
Frucht hat 2 Samen  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Frucht mit Flügeln
Frucht mit Flügeln  Frucht mit rückgebogenen Stacheln, hakenförmige oder widerhakenförmige Haare
Frucht mit rückgebogenen Stacheln, hakenförmige oder widerhakenförmige Haare  Frucht mit Stacheln und Haken
Frucht mit Stacheln und Haken  Samen mit Flügeln
Samen mit Flügeln  Samen mit Haaren
Samen mit Haaren  Samenmantel oder mantelähnliche Organe vorhanden
Samenmantel oder mantelähnliche Organe vorhanden  Keim gerade
Keim gerade  Keim gekrümmt
Keim gekrümmt  Samen ohne Nährgewebe
Samen ohne Nährgewebe  Samen mit Nährgewebe
Samen mit Nährgewebe  Nährgewebe langsam übergehend
Nährgewebe langsam übergehend Verbreitung
 Asien
Asien  Europa
Europa  Nordamerika
Nordamerika  Previous
Previous