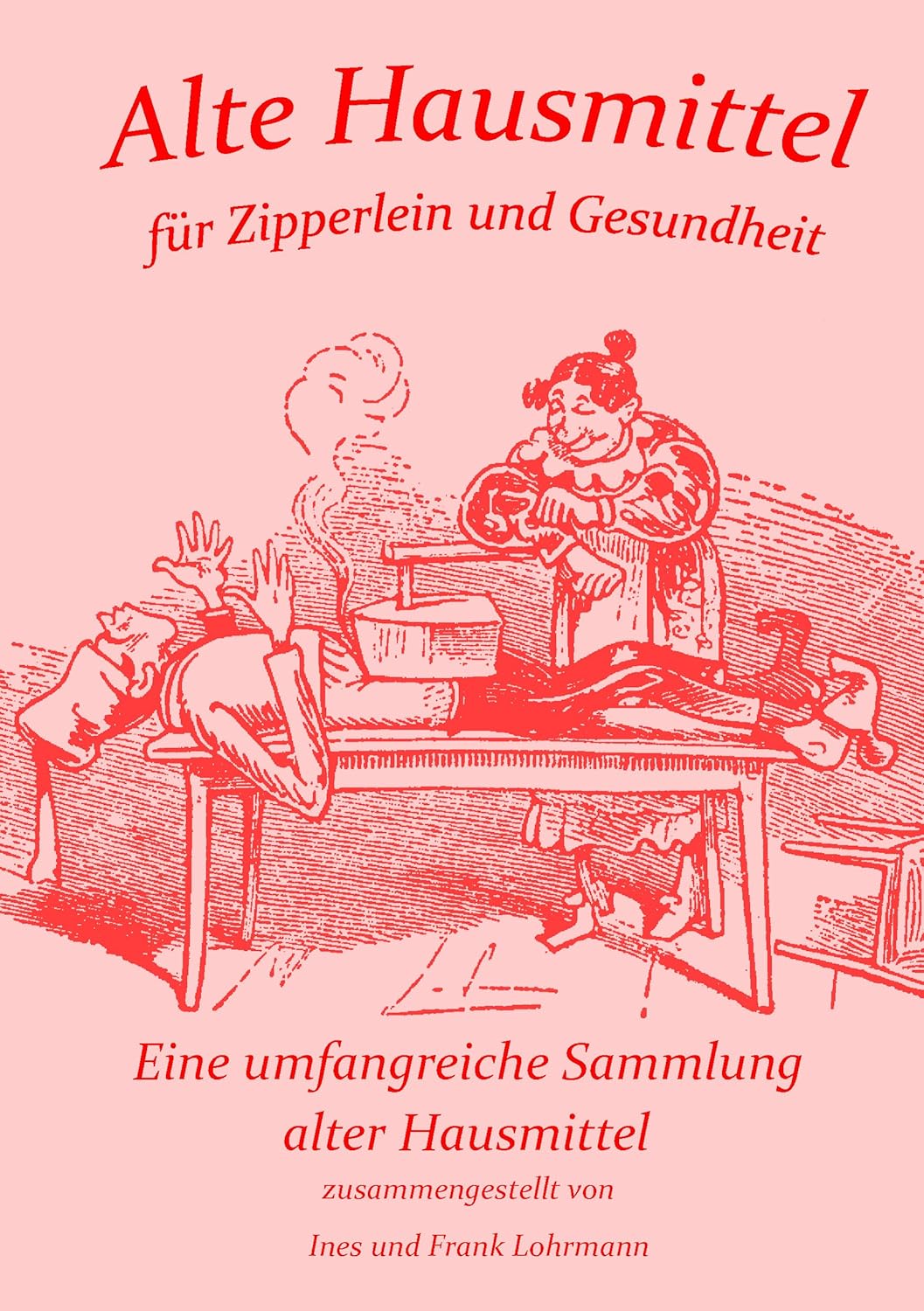Unsere Facebook-Gruppe: Heilpflanzen als Medizin
Kap-Aloe - Aloe ferox Mill.
Englisch: Bitter aloe, Cape Aloe, Cape Aloë, Cape prickly aloe, Common aloe, Cultivated aloe, Lucid Aloe, Medicinal aloe, New aloes, Red aloe, Tap aloe

Bild © (1)
Synonyme dt.:
Afrikanische Aloe
Aloë
Berg-Aloe
Bitter-Aloe
Kap-Aloe
Synonyme :
Aloe candelabrum A.Berger
Aloe ferox subsp. galpinii
Aloe ferox subsp. incurva
Aloe ferox subsp. subferox
Aloe ferox var. galpinii (Baker) Reynolds
Aloe ferox var. incurva Baker
Aloe ferox var. incurvata Baker
Aloe ferox var. subferox (Spreng.) Baker
Aloe galpinii Baker
Aloe horrida Haw.
Aloe muricata Haw.
Aloe pallancae Guillaumin
Aloe perfoliata subsp. ferox
Aloe perfoliata var. ferox (Mill.) Aiton
Aloe pseudoferox Salm-Dyck
Aloe subferox Spreng.
Aloe supralaevis Haw.
Aloe supralaevis subsp. erythrocarpa
Aloe supralaevis var. erythrocarpa Baker
Busipho ferox (Mill.) Salisb.
Pachidendron ferox (Mill.) Haw.
Pachidendron pseudoferox (Salm-Dyck) Haw.
Pachidendron supralaeve (Haw.) Haw.
Pachydendron ferox (Mill.) Haw.
Pachydendron pseudoferox (Salm-Dyck) Haw.
Blatt: Die dicken, fleischigen Blätter sind dicht-spiralig angeordnet. Blattrand und Blattspitze sind meist dornig bewehrt. Die dunkelgrünen, lanzettlichen Blätter bilden eine dreißig- bis fünfzigblättrige Rosette auf einem Stamm von etwa 10 cm Dicke und einer Höhe bis zu 6 m. Sie sind dunkelgrün und werden bei einer Breite von etwa 12 cm bis zu 60 cm lang. An den Rändern tragen sie dicht stehende, braune Dornen.
Stengel bzw. Stamm: kraut- oder strauchartige Gewächse. Die Wurzel ist faserig-ästig.
Blüte: Die Blüten stehen an aufrechten, mehr oder weniger langen Schäften in dicht-traubiger, spiraliger Anordnung. Der Blütenschaft von etwa 50 cm Höhe trägt die Traube der roten, grün gestreiften Blüten, die etwa 3 cm lang sind.
Frucht bzw. Samen: Die Frucht ist eine walzliehe, häutige, dreifächerige Kapsel.
Vorkommen: Vorkommen: Eingebürgert aus Gärten in der Nähe der Küste von Südostfrankreich; ursprünglich aus Südafrika.
Weitere Informationen, Nutzen: (Wichtiger Hinweis!)
Mehrere Arten der Gattung Aloe liefern die offizinelle Droge Aloe, welche schon zwei bis drei Jahrtausende v. Chr. im nördlichen Afrika als Heilmittel verwendet wurde. Auch die klassische Antike und Indien kannten die abführende und stärkende Wirkung der Aloe. Den berühmten arabischen Ärzten des Mittelalters war die Droge auch bekannt, ebenso war sie in England wohl schon im 10. Jahrhundert in Gebrauch, da sie zu den Heilmitteln gehört haben soll, die der Patriarch von Jerusalem Alfred dem Großen empfahl. In Deutschland wurde der Succus Aloes inspissatus im 12. Jahrhundert durch Albertus Magnus eingeführt.
Die Gewinnung der Droge geschah auf folgende Weise: Eine Bodenvertiefung wird mit einem Ziegen- oder Pferdefell
ausgekleidet und rund um diese ein kuppelartiger, bis zu 1 m hoher Bau von Aloeblättern so aufgeschichtet, dass alle Schnittflächen nach der Vertiefung gerichtet sind und der aus ihnen ablaufende Saft in die Vertiefung fließt. Von dort wird er nach einigen Stunden in Kanister u. dgl. umgefüllt und dann von den Eingeborenen auf freiem Feuer unter Umrühren eingekocht. Manche Mütter bestreichen mit der Aloetinktur die Finger der Kinder, um ihnen das Daumenlutschen oder Nägelkauen abzugewöhnen.
Medizinisch:
Der Blattsaft wird bei chronischer Konjunktivitis als Augentropfen verwendet, äußerlich dient er der Behandlung von Prellungen, Verbrennungen, Hautirritationen und Schlangenbissen. Die Blätterinfusion oder Blätterabkochung wird bei Gonorrhoe, als Malariaprophylaxe und Abführmittel genutzt.
Aktivität:
Abführend; Anti-Sarkom Keimtötend; Antiallergisch Keimtötend; Antibakteriell Keimtötend; Antihistaminisch; Entzündungshemmend Antimutagen; Fungizid; Immunstimulans; Phagozytierend; Wundheilend;
Indikation:
Allergie dämpfend; Arthrose; Augenentzündungen; Bakterien tötend; Bluthochdruck; Ekzeme und Neurodermitis; Entzündungen; Entzündungen; Immunodepression; Infektion; Krebs; Nebenhöhlenentzündungen; Pilze Keimtötend; Pilzinfektionen; Schmerzen; Stress; Tumor; Verstopfung;
Dosis:
0,25-0,1 g als appetitanregendes Bittermittel (Hager);
0,2-1,0 g als Purgans
8-10 Tropfen der Tinktur mehrmals täglich
In der Homöopathie: dil. D 2-4, dreimal täglich 10 Tropfen.
Gegenindikation, Nebenwirkungen und Seiteneffekte:
Nicht in der Schwangerschaft; Überdosierungen können zu Durchfall, Magenerkrankungen und Psychosen führen. Der Nektar ist möglicherweise Betäubend.
8 g wirken tödlich. Kaiser Otto II. bekam nach 16 g Aloe eine tödlich endende hämorrhoidale Darmentzündung.
Speisewert:
Medizinisch
5 Bild(er) für diese Pflanze
Abmessungen:
Frucht Größe:
Samen Größe:
Wuchsform
 Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher
Gehölze, Bäume excl. Halbsträucher Blütezeit
Pflanze Jährigkeit
Haare
Blätter
 Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)
Blätter wechselständig (exkl. Zweizeilig bei Einkeimblättriten)  Blätter einfach, ungeteilt
Blätter einfach, ungeteilt  Aderung in Längsblätter oder Teile (inkl. 3-teilige Blätter)
Aderung in Längsblätter oder Teile (inkl. 3-teilige Blätter)  Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile
Blattränder ohne Lappen, Zähne, Teile  Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.
Bltter oder Blatteile gezahnt, gesägt, gekerbt, usw.  Nebenblätter fehlen
Nebenblätter fehlen Blütenstand
 Blüte einzeln
Blüte einzeln  Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial
Blütenstand eine Spitze, einfach und monopodial  Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial
Blütenstand ein Kopf, einfach und monopodial  Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.)
Blütenstand verbunden, sympodial oder monopodial (Rispe, Thyrsos etc.) Blüten
 bisexuell
bisexuell  unisexual
unisexual  actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.
actinomorph bzw. Sternförmig, Radialsymetrisch, Radförmig usw.  Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)
Blütenboden klein, (oberständiger Fruchtknoten)  Keine Staubgefässe
Keine Staubgefässe  Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6
Blütenhülle (Perianth) Segmente: 6  Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten
Blütenhülle besteht aus ähnlichen Segmenten  Blütenhülle von Kelch und Krone
Blütenhülle von Kelch und Krone  Kelchblätter 3
Kelchblätter 3  Kelchblätter mehr als 5
Kelchblätter mehr als 5  Kelchblätter untereinander frei
Kelchblätter untereinander frei  Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)
Kelchblätter verwachsen (mindestens 2)  Kelchblätter schuppig oder verzerrt
Kelchblätter schuppig oder verzerrt  Blütenblätter 0 (inkl. Einem becherartigen Blütenkrone ohne Blätter)
Blütenblätter 0 (inkl. Einem becherartigen Blütenkrone ohne Blätter)  Blütenblätter 3
Blütenblätter 3  Blütenblätter alle frei voneinander
Blütenblätter alle frei voneinander  Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)
Blütenblätter verwachsen (mindestens 2)  Staubbeutel 6, fruchtbar
Staubbeutel 6, fruchtbar  Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert
Staubbeutel dorsal oder herzförmig fixiert  Staubbeutel an der Basis fixiert
Staubbeutel an der Basis fixiert  Staubbeutel nach Innen gerichtet
Staubbeutel nach Innen gerichtet  Staubbeutel länsschlitzig öffnend
Staubbeutel länsschlitzig öffnend  Staubblätter frei von Krone
Staubblätter frei von Krone  Staubblätter in die Krone eingefügt
Staubblätter in die Krone eingefügt  Staubfäden nicht verwachsen
Staubfäden nicht verwachsen  Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)
Mehr als 1 Stiel, frei (Fruchtblätter verwachsen)  Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)
Stiel 1, oder: Stiele mehr oder weniger verwachsen (Fruchtblätter frei oder verwachsen)  Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)
Fruchtblätter 3 (frei oder vereinigt)  Fruchknoten 1-kammerig
Fruchknoten 1-kammerig  Fruchknoten 3-kammerig
Fruchknoten 3-kammerig  1 Samen pro Fruchtkammer
1 Samen pro Fruchtkammer  Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer
Mehr als 2 Samen pro Fruchtkammer  Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen
Samenanlagen zentral, Fruchtblätter verwachsen  Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt
Samenanlagen mittig befestigt, oder bauchseits, wenn Fruchtblätter frei oder 1 Fruchtblatt  Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt
Samenanlagen an der Basis des Fruchtknotens befestigt Früchte
 Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)
Frucht ist eine Kapsel (inkl. Hülse, Schote, Balgen)  Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)
Frucht ist eine Nuss (inkl. Schließfrucht, Spaltfrucht usw.)  Frucht hat 1 Samen
Frucht hat 1 Samen  Frucht hat mehr als 2 Samen
Frucht hat mehr als 2 Samen  Frucht mit Stacheln und Haken
Frucht mit Stacheln und Haken  Keim gerade
Keim gerade  Samen mit Nährgewebe
Samen mit Nährgewebe Verbreitung
 Asien
Asien  Europa
Europa  Previous
Previous